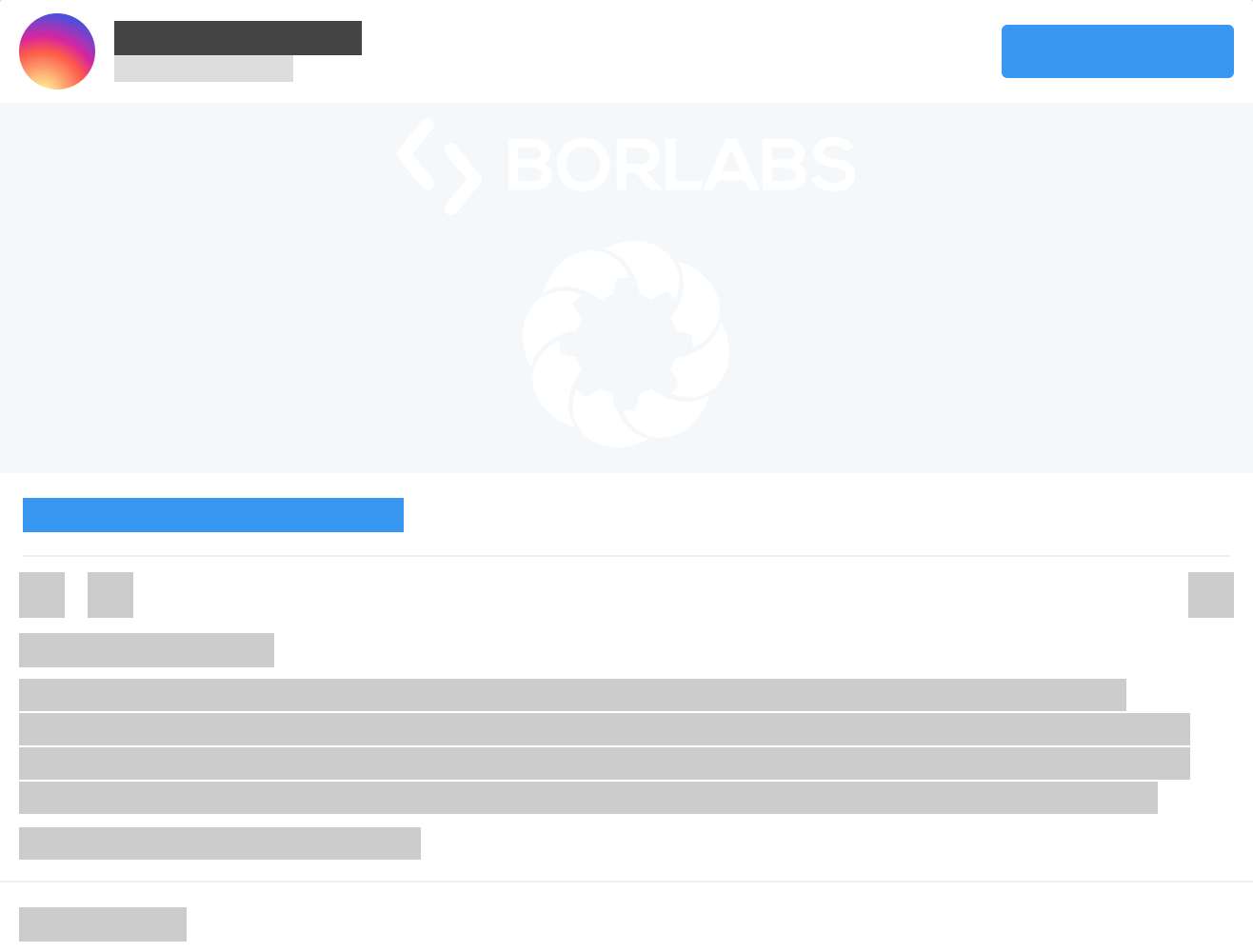10 Dinge, die du kennst, wenn du in Wien aufgewachsen bist
Ihr habt beim Urlaub auf dem Bauernhof mit eurem „ur leiwanden“ Dialekt den Grant der Dorfbevölkerung auf euch gezogen und beurteilt Menschen nach ihrem Herkunftsbezirk? Dann seid ihr wahrscheinlich ebenfalls in Wien aufgewachsen.


„Eine echte Wienerin?“, werde ich erstaunlich oft gefragt, als wäre ich das letzte Einhorn in Schönbrunn. Und während ich noch überlege, ob ich jetzt eine Predigt darüber halten soll, dass es „echte Wiener“ nur im Fernsehen gibt und solche Labels generell ziemlich fragwürdig sind, sage ich inzwischen einfach resignierend: „Ja, born and raised in Simmering“, und mache dazu meist noch irgendeinen Gangster-Move, der bei mir als insgeheimes Streberkind immer ein bisschen so aussieht, als hätte ich einen Krampfanfall.
Ich bin also in Wien aufgewachsen. Das war für mich lange Zeit nicht wirklich etwas Besonderes. Und dann kam 1000things und plötzlich bin ich eine der wenigen Quoten-Wiener*innen zwischen einer liebenswürdigen Mischkulanz aus „den Bundesländern“ (sie hassen es, wenn ich das sage). Deshalb habe ich diese sagenumwobene, ominöse Kindheit und Jugend in der Hauptstadt Revue passieren lassen und bin auf einige Dinge gestoßen, die man wohl nur kennt, wenn man selbst im Wiener Wasserkopf groß geworden ist.
Der Hass auf die Wienerkinder
Und wie das oft der Fall ist, wenn man eigentlich über sich selbst nachdenken soll, reden wir lieber erst einmal über die anderen. Definitionen funktionieren manchmal eben am besten ex negativo. Denn wer wohl die stärkste Meinung über die leidigen Wiener G’schrappen hat, das sind die Landkinder. Ja, ganz genau, ihr, die ihr in eurer Kindheit über satte Wiesen gehüpft seid wie die verdammte Trapp-Familie und Milch direkt aus dem Euter getrunken habt. Zumindest inszeniert ihr euch doch so gerne als die hartgesottenen, total naturverbundenen Crocodile-Dundees des Alpenlands, die immer ganz mitleidig dreinschauen, wenn man erzählt, dass man in Wien aufgewachsen ist.
Egal ob Skiurlaub oder Ausflug auf dem Bauernhof – als Wiener Kind hatte man es ziemlich schwer, in „den Bundesländern“ Anschluss zu finden. Ja, man stieß meistens sogar auf brüskierte Ablehnung und fast schon panische Abschottungsversuche, wenn es wieder einmal hieß: „Die Wiener*innen kommen!“ Da ließ man einmal unabsichtlich das vermaledeite „Ur“ oder „Oida“ fallen, und schon war man enttarnt als weltfremdes, verwöhntes „Stadtkind“ oder „Stadtpflanze“, die offenbar in einem fort darüber belehrt werden müssen, dass Kühe in echt gar nicht lila sind und die Milch nicht aus dem Packerl kommt.
„Hast du Ziegen überhaupt schon mal in echt gesehen?“, hat mich auch als Erwachsene noch eine Bekannte ernsthaft gefragt. Ähm, ja? Das sind doch diese kleinen, bellenden Vierbeiner, die überall hinbrunzen, oder? Anscheinend ist ein Basiswissen über heimische Nutztierrassen auf Volksschulniveau außerhalb des Wiener Wasserkopfes ultimatives Statussymbol.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Die Bezirksrivalitäten
Aber als Kind ist mir das offen gestanden nie so wirklich aufgefallen. Wahrscheinlich lag das daran, dass auch die Wiener*innen innerhalb der imaginären Stadtmauer gerne kleingeistige Regionalrivalitäten betreiben. In Wien bist du nie einfach nur Wienerin, du bist der Bezirk, aus dem du kommst. Mit Simmering hatte ich da schon als Jugendliche ein schweres Los. Immerhin ist der elfte Hieb gemeinhin als hartes Pflaster verschrien, das Sodom und Gomorrha aussehen lässt wie einen Kinderspielplatz.
Und kamst du dann auch noch an Polo-Shirt tragende, Treuhandfond besitzende Jugendliche aus Bezirken wie Währing oder Döbling, warst du sowieso der unzivilisierte Überprolo des Abends. Jetzt auch noch mit frisch angeeignetem Sachbuchwissen über gar nicht lila Kühe glänzen zu wollen, wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Also war mein Allround-Argument immer: „Na und? Wir haben den Zentralfriedhof.“ Im Nachhinein wohl auch nicht der distinguierteste Konter.

Die Tanzschule
Besonders rasant flog mir dieses Bezirksgefälle übrigens in der Tanzschule um die Ohren. Entgegen aller Proto-Prolo-Vorurteile haben sie nämlich auch mich mit 16 in eine der Tradition transpirierenden Besserungsanstalten für linke Füße geschickt, wie es bei uns in der Familie, und in vielen anderen Wiener Familien, eben so Brauch ist. Was in den USA der Debütantinnenball, ist in Wien nun einmal der Jugendtanzkurs.
Und was die „Gilmore Girls“ in nur einer Folge abhandeln konnten, begleitete mich ein ganzes Schuljahr lang. Als Schülerin aus einer No-Name-Schule im 11. Bezirk war mir im Vorhinein aber nicht klar, dass offenbar jede der Wiener Eliteschulen einen bestimmten Wochentag in meiner Traditionstanzschule frequentierte. Welch Ironie: In meinem Gymnasium hatten wir nicht einmal unsere Turnhalle für uns alleine.
Und schon stand ich in einer Reihe mit den Hochwohlgeborenen aus der Stubenbastei und musste pubertär verunsicherten Burschen in durchgeschwitzten weißen Stoffhandschuhen dabei zusehen, wie sie ihre ganze Coolness zusammenrafften und den Mädchen entgegenmurmelten: „Darf ich bitten?“ So viele überartikulierte Diphthonge wie in meiner Zeit beim Elmayer habe ich später selten in einer solchen Frequenz gehört.
Die Erkenntnis, dass es wohl fast so etwas wie eine philosophische Grundsatzdebatte ist, wer wem im Falle einer Drehtür den Vortritt lässt, kann mir keiner mehr nehmen. Wer denkt, man schicke Jugendliche nur in die Tanzschule, damit sie peinlich berührt zusammen bis ins 19. Jahrhundert zurück gegen den Takt antanzen, hat das Prinzip nicht verstanden.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Die Kindergeburtstage bei McDonalds
Ungefähr genauso aufregend waren für mich übrigens Kindergeburtstagsfeiern – als höchst introvertiertes Kind generell, aber in einem Setting ganz besonders. In jeder Klasse gab es nämlich immer mindestens ein extrem cooles Kind, das seine Party in der Fastfood-Hochburg höchst selbst ausrichten durfte, inklusive Bällebad, Hintergrundführung in die deprimierende Großküche und Happy Meals für alle. Und dieses Kind war ich – nicht. Aber die eine oder andere Schlacht im Bällebad, während die Eltern in einem abgetrennten Glaskobel mit sich selbst beschäftigt waren, habe ich trotzdem ausgefochten. Nimm das, Justin!
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Das Ferienspiel
Zu tun und zu erleben gibt es in der Großstadt natürlich jederzeit mehr als genug. Und als Kind besonders in den Schulferien. Offiziell vertreten durch den gelben Holli Knolli, wahrscheinlich entfernt verwandt mit der Kartoffelkopf-Dynastie, versorgte uns das Ferienspiel von wienXtra von Klein bis Mittelgroß mit den unterschiedlichsten To Dos, Kursen und sonstigen Freizeit-Spaßettln. Immer, wenn in der Schule die Ferienspiel-Pässe verteilt wurden, wussten wir: Bald ist Sommer! Und wenn der vorbei war, wussten wir genau, wer wirklich viel erlebt hat: die Wichtigtuer mit dem vollen Stempelpass.
Konzerte und Skateparks
Später, in der fortgeschrittenen Pubertätsperiode, sind wir dann regelmäßig zum wienXtra-Büro am Burgring zurückgekehrt. Nicht etwa, weil wir noch eine Rechnung mit Holli Knolli offen hatten, sondern der Konzertkarten wegen. Die gab’s dort nämlich besonders günstig inklusive mehrseitiger Liste mit allen relevanten Konzerten, die in nächster Zeit anstanden.
Wer damals nicht im abgedunkelten Kinderzimmer gesessen ist, mit Leuchtstift die relevanten Bühnenshows gekennzeichnet hat und schließlich daran verzweifelt ist, dass sich 200 Konzerte in den nächsten zwei Monaten wohl finanziell nicht ganz ausgehen werden, der werfe den ersten Drumstick, den wir wahrscheinlich niemals gefangen hätten. Hach.
Mit dieser Phase meiner fortschreitenden Jugend ging es übrigens Hand in Hand, in Skateparks abzuhängen. Besonders praktisch: Dafür musste man nicht einmal skateboarden können, ja nicht einmal ein eigenes Skateboard besitzen. Es reichte, wenn man dabei war – und gelegentlich ein warmes Bier von der Tankstelle mitbrachte. Das waren Zeiten.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Führerschein – was ist das?
Die Jahre ziehen dahin, ziehen an der ersten Zigarette und am ersten Hochprozentigen vorbei und schon ist man erwachsen. Initiationsritus dafür, ja so etwas wie das Abzeichen für das unbeschadete Überleben der ersten 17 bis 18 Lebensjahre, ist auf dem Land der Führerschein, habe ich mir zumindest sagen lassen. Denn wenn du bis Mitte 20 nicht weißt, wo Kupplung, Bremse und Gas sind und dich hartnäckig von anderen herumkutschieren lässt, dann bist du entweder ein Stadtkind oder fährst verdammt schlecht Auto.
Auch ich habe mich unverhältnismäßig lange gegen den Führerschein gesträubt. Was mache ich denn auch in der Stadt mit einem Auto? Überall, wo ich hin will, komme ich problemlos mit den Öffis und kann dabei auch noch andere Leute beobachten – das etwas andere Stationentheater. Aber spätestens wenn du das erste Mal im Möbelhaus stehst und überlegst, ob der neue Ohrensessel wohl problemlos durch die U-Bahn-Tür passt, erwischst du dich dann doch dabei, wie du mit dem Gedanken spielst, endlich selbst fahren zu können. Und schon sitzt mal mit lauter deutlich jüngeren Fahr-Azubis im Theoriekurs.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Der Schwedenplatz
Auch wenn man sich den Führerschein vielleicht bis zuletzt ersparen konnte, um eines kommt man als Jugendliche auf Leppschi in Wien definitiv nicht herum: den Schwedenplatz. Natürlich könnte ich jetzt so tun, als wüsste ich das nur, weil ich das little Mallorca von Wien durchqueren musste, um ins Flex oder Bricks zu gehen.
Aber wen will ich hier belügen? Ich bin mir sicher, alle von uns, die ihre prägenden Jahre zwischen letztem Milch- und erstem Weisheitszahn in Wien verbracht haben, sind mindestens schon einmal in irgendeiner Tschumsen am Schwedenplatz versumpert, haben viel zu billige, viel zu starke, viel zu giftfarbene Drinks geext und danach um vier Uhr Früh die fetttriefenden Happy Noodles inhaliert, als gäb’s kein Morgen mehr. Und das gab es ja auch wirklich nicht, weil man danach meist schlief bis übermorgen.
Der Schwedenplatz war für uns jedenfalls der Ort, an dem man seinen Samstagabend verbrachte, wenn sonst nichts los war. Das Trash-Fernsehen unter den Feiermeilen quasi. Uns zog es damals etwa immer wieder in das Lokal mit dem unbemüht trivialen Namen Swizzl, das es inzwischen längst nicht mehr gibt: ein Boden mit der Klebestärke 100, durchgewetzte Lederbarhocker, Musik frisch gezapft von LimeWire, aber dafür ein Meter Saurer Apfel um neun Euro. Was will man mehr?
Der Flex-Opa
Wenn wir das Herumsitzen aber irgendwann über hatten, zog es uns manchmal tatsächlich in Richtung Donaukanal, genauer gesagt ins Flex. Dort fühlten wir uns besonders cool, besonders hipp – und schlagartig besonders jung, wenn uns jene sagenumwobene Gestalt des Wiener Nachtlebens entgegentaumelte, die gemeinhin Flex-Opa genannt wurde.
Warum, ist schnell erklärt: Er war so gut wie immer im Flex und sah aus, als könnte er unser Opa sein – gesetzt den Falles, unser Opa trägt schlohweißes Haar, steht auf LSD und beutelt Tanzbewegungen aus dem Ärmel, die Performance-Künstler*innen vor Neid erblassen lassen.
Gut, das mit dem LSD ist natürlich ein Gerücht. Genauso wie seine Geschichte generell: Die einen munkeln, dass er irgendwas mit Biologie auf der BOKU unterrichtet hat, die anderen meinen, er war mal auf der Angewandten. So genau scheint das bis heute keiner zu wissen. Gefragt haben wir ihn jedenfalls nie. Aber getanzt haben wir mit ihm, Generationen übergreifend.
Die Nightline
Wenn mir meine lieben Kolleg*innen aus „den Bundesländern“ (ja, ich ziehe das beinhart durch) ihre Fortgehgeschichten von sündhaft teuren Überlandfahrten mit dem Taxi oder stundenlangen Fußmärschen querfeldein erzählen, kann ich zum Glück nicht mitreden. Der einzige Kraftakt war es in Wien Prä-Nacht-U-Bahn, die richtige Nightline zu erwischen und nicht gleich wieder nach draußen zu hechten. Die Nachtbusse, die es natürlich heute immer noch gibt, sammelten die ausgelaugten, zerfeierten Überbleibsel, in der Nase nistete sich hartnäckig ein Mischmasch aus abgestandenem Alkohol, Rauch und Imbissbude ein und das fade Aug‘ hing bis zum Boden.
Nein, auf Äußerlichkeiten gab man in diesem Stadium des Abends nichts mehr, da ging es schlicht und einfach nur noch ums blanke Heimkommen. Für ein paar Stationen, die sich immer anfühlten, als würden sie Welten auseinanderliegen, war jede Eitelkeit, jede Oberflächlichkeit vergessen, und ja, manch einer schnarchte auch genüsslich vor sich hin. Idyllisch? Nein. Romantisch? Ganz sicher nicht. Aber immerhin besser, als am nächsten Tag in einem Maisfeld aufzuwachen, weil man es nicht heim geschafft hat.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren