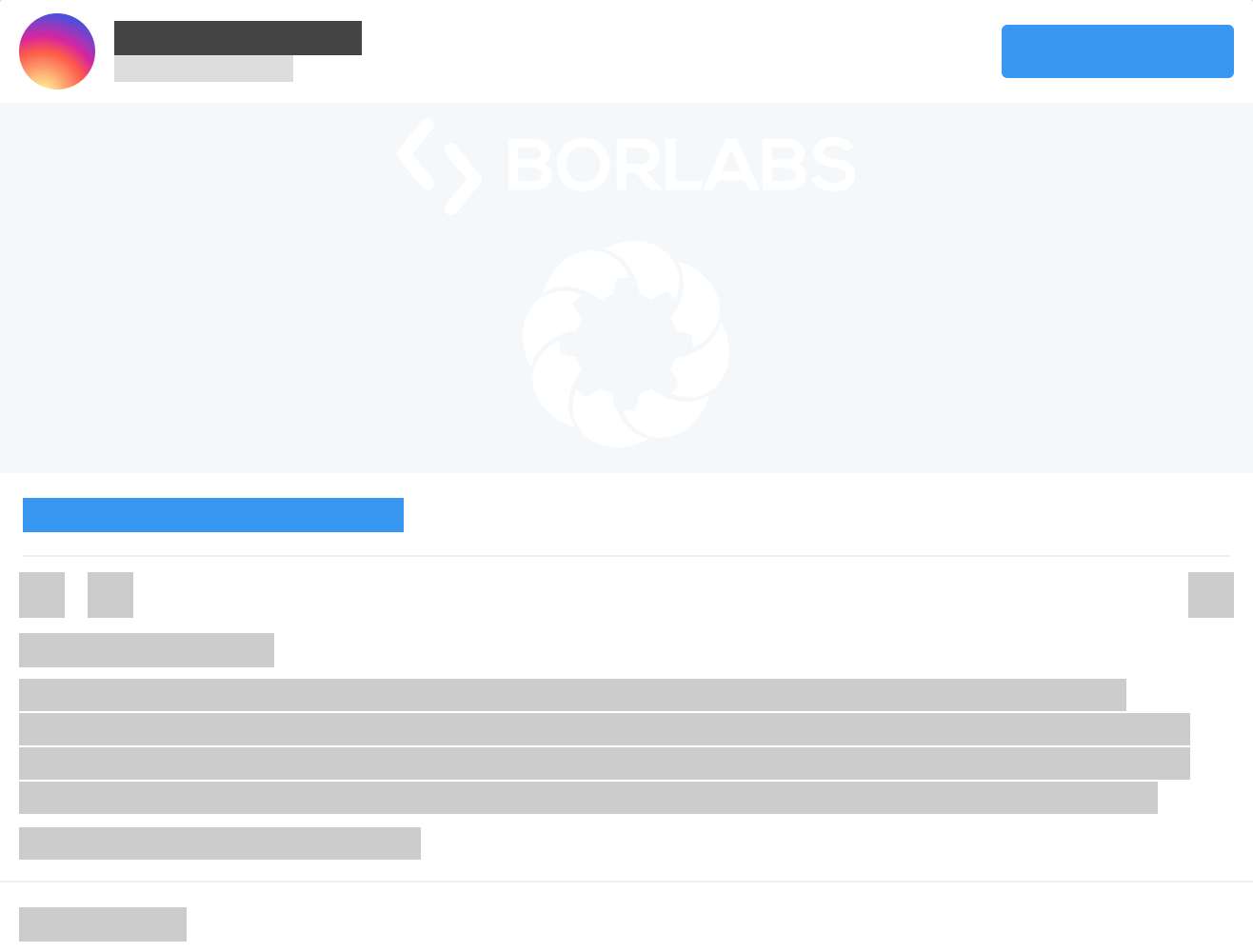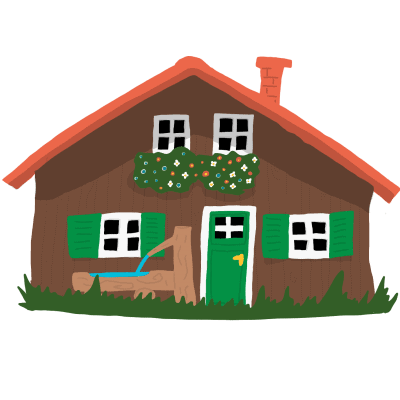Lebende Statue: Die silberne Frau vorm Goldenen Dachl
Wer steckt eigentlich hinter einer der lebendigen Statuen, um die sich in jeder größeren Stadt die Touristinnen und Touristen scharen? Wie ist es, den ganzen Tag lang stillstehen zu müssen? Und wie oft wird einem das gesammelte Geld geklaut? Das und vieles mehr fragen wir uns bei fast jedem Stadtbummel. In Innsbruck haben wir uns mit der „Silbernen Frau“ Maria zum Kaffee getroffen. Ganz privat und ungeschminkt.


Dieser Artikel ist im Juni 2018 entstanden. Alle beschriebenen Situationen und Aussagen beziehen sich auf diesen Zeitraum.
Wie fast jeden Tag schnappt sich Maria in der Früh ihren Hund Canelo und fährt mit dem Rad zur Arbeit. Am Ende der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße, der größten Touri-Meile der Stadt, macht sie halt – nur ungefähr eine Gehminute vom Goldenen Dachl entfernt. Auf der Toilette eines Lokals in unmittelbarer Nähe schmiert sie sich Gesicht und Hals mit Feuchtigkeitscreme ein und spachtelt sie mit silberner Schminke zu. Alles ist Silber: Lippen, Augenlider, Nasenflügel. Ihr Hut und die Perücke aus Korkenzieher-Locken – ebenfalls Silber. Maria kehrt zurück auf die Straße. Mitten auf der beginnenden Herzog-Friedrich-Straße, in die die Maria-Theresien-Straße mündet, stellt sie ihr kleines Podest im Säulen-Look auf. Sie schlüpft in ihr aufwändiges Rokoko-Kleid, steckt Canelo in einen Retro-Kinderwagen, den sie neben ihre Säule stellt, und steigt aufs Podest. Und genau da wird sie die nächsten Stunden stehen. Starr. Fast unbeweglich. Nur ab und zu ein Zwinkern hier oder ein Luftkuss da. Eine lebendige Statue.
Die Statue ohne Kostüm
Der Tag, an dem ich Maria eine Zeitlang dabei beobachte, ist sonnig. Die Touristinnen und Touristen scharen sich pausenlos um sie. Ein kurzer, amüsierter Zwischenstopp auf dem Weg zum Goldenen Dachl. Strategisch ist das hier offenbar ein unglaublich wertvoller Platz für eine Straßenkünstlerin. Genau hier wollen wir uns am folgenden Tag zu einem Interview treffen. Nur weiß ich leider nicht, nach wem ich Ausschau halten soll. Immerhin habe ich Maria nur einmal gesehen, und das in Ganzkörper-Silber.
Nur Hund Canelo erkenne ich auf Anhieb wieder. Der kleine, beige Mischling hängt an der Leine einer schmalen Frau in High Heels und Hotpants mit unglaublich langen, braunen Haaren. Sie erinnert mich auf den ersten Blick an eine Tänzerin: Ihre Ausstrahlung fröhlich und offen, aber zugleich eisern diszipliniert. Irgendwie Ehrfurcht gebietend. Aber auf eine ganz andere Art als die mimikreduzierte Halb-Statue-Halb-Frau-Erscheinung, mit der ich am Vortag noch gesprochen hatte.

Sie isst da, wo sie sich schminkt
Als ich Maria mit dem „Jetzt hätte ich dich fast nicht erkannt“-Schmäh komme, winkt sie ab und lacht höflich. Den hört sie vermutlich öfter. Wir steuern jedenfalls das Lokal an, in dem sie sich täglich auf- und abschminkt. „Weil ich jeden Tag die Toilette hier benutze, mache ich auch meine Mittagspausen immer hier oder komme auf einen Kaffee vorbei, um dem Lokal etwas zurückzugeben. Das ist nur fair“, erklärt sie. Wenn sie Pause macht, trägt sie zwar ihr Kleid nicht, aber sich abzuschminken und die Perücke abzunehmen, wäre doch etwas zu aufwendig. Oben Silber, unten in ihren normalen Klamotten, sieht sie dann ein bisschen so aus, als hätte man einem Menschen aus dem 21. Jahrhundert eine Biedermeier-Büste aufgesetzt. Damit sie die Touristinnen und Touristen nicht ständig auf ihre groteske Gesichtsfarbe ansprechen, verzieht sie sich normalerweise in die hinterste Ecke des ersten Stocks. Heute ist sie aber in zivil, also setzen wir uns an einen Tisch auf der Straße.
Aber auch ohne Kostüm kennt man sie hier: In ihrem Deutsch mit Tiroler Einsprengseln und spanischem Akzent plaudert sie quirlig mit dem Kellner, scherzt freundschaftlich mit dem Lokalbetreiber. „Café Latte, wie immer“, sagt sie schließlich, und zündet sich eine Zigarette an. Die silberne Statue ist privat also ein bunter Hund. Dass ausgerechnet jemand so Aufgewecktes sich einen Job aussucht, bei dem man stundenlang stillstehen muss, wundere ich mich, während Maria noch ein paar Worte mit dem Lokalbetreiber wechselt.
Stillstehen, um rumzukommen
Ursprünglich kommt sie aus Barcelona. Dort jobbte sie zunächst in einer Gärtnerei und in der Gastronomie. Mit 20 entschied sie sich schließlich für ein Leben als Statue, gerade weil sie privat alles andere als stillstehen wollte: „Ich habe immer davon geträumt zu reisen. Bloß Urlaub zu machen, konnte ich mir aber nicht leisten. Und ich konnte keine andere Sprache außer Spanisch und Katalanisch“, erzählt Maria. Zum Glück ist Stille international: „Als Statue konnte ich reisen und gleichzeitig etwas verdienen, ohne die Sprache zu kennen.“ Genial eigentlich.
20 Jahre lang lebt Maria nun schon als Statue: Sieben davon tingelte sie durch den deutschsprachigen Raum, bevor sie sich vor 13 Jahren in Innsbruck niederließ. Wenn sie so davon erzählt, klingt das für mich als tendenziell feigen Nesthocker wie das ideale Abenteurerleben, wie eine Geschichte aus einem Kinderbuch über eine mutige Rebellin, die auszog, um die Welt zu sehen. Wie Pipi Langstrumpf mit viel mehr Schminke. Aber funktioniert das wirklich so einfach, dass man die Koffer packt, mal eben in eine neue Stadt fährt und sich dort stockstarr in die Fußgängerzone stellt?
Auch Globetrotter kommen der Finanz nicht aus
„Früher war das viel freier“, erklärt Maria. „In den meisten Städten gab es zwar keine offizielle Erlaubnis dafür, aber verboten war es auch nicht, solange man den Eingangsbereich der Geschäfte nicht störte.“ In Innsbruck musste sie sich dafür erst einmal eine Genehmigung von der Stadt holen. Die sichert ihr dafür aber auch ihren idealen Spot in der Nähe des Goldenen Dachls. Außerdem ist Maria als Selbstständige angemeldet mit SVA-Abgaben, Steuerausgleich und allem Drum und Dran. Der ganze Heute-hier-morgen-da-Lifestyle funktioniert also auch nicht ohne bürokratischen Papierkram. Selbst als Statue kommt man der Finanz eben nicht aus.
Trotzdem: Im Herzen ist Maria eine Reisende. Bis nach Neuseeland führte sie ihre Arbeit sogar schon, erzählt sie mit in die Ferne driftendem Blick. Einen ganzen Monat lang hat sie dort im Rahmen eines Straßenkunst-Festivals als Statue posiert. Heute nimmt sie aber kaum mehr an Festivals teil. „Ich brauche Routine in meinem Tag. Ich komme einfach gerne jeden Abend heim in meine Wohnung“, seufzt Maria. Dann setzt sie lachend nach: „Immerhin bin ich nicht mehr 20!“ Fast kommt ein bisschen Wehmut auf. Wir lachen beide kurz. Sie ehrlich, ich unbeholfen.
20 Jahre harte Arbeit
Dann schweigen wir und ziehen nachdenklich an unseren Zigaretten. Maria denkt wahrscheinlich gerade an Neuseeland, und ich denke daran, dass 20 Jahre Straßenkunst eine verdammt lange Zeit sind. Vor allem, weil das Geld alles andere als leicht verdient ist, wie mir Maria dann erzählt. Wer schon mal länger als eine halbe Stunde in einem rappelvollen Zug gestanden ist, weiß, wie anstrengend Stehen werden kann. Und Maria kann sich weder anhalten noch mit der Hüfte hin und her wippen. Sie muss starr stehen. Stundenlang. Das geht auf die Gelenke, das geht auf die Konzentration. „Mit der Zeit tun die Füße weh. Ich habe Hornhaut auf den Füßen, die ich manchmal wegschneiden muss. Auch der Rücken schmerzt nach und nach“, sagt Maria. Aber sie beschwert sich nicht: „Das ist eben wie bei jeder anderen Arbeit auch. Wenn du acht Stunden lang sitzt, tut dir irgendwann auch alles weh.“
Statue-Stehen ist ein bisschen wie fernsehen
Ob es da nicht ein paar Tricks gibt, das lange Stehen auszuhalten? „Das ist Übungssache. Manche glauben, ich meditiere dabei, aber das ist keine gute Idee, weil ich mich dann zu sehr entspannen und vielleicht sogar einschlafen würde“, verrät Maria. Ihr Podest ist nicht besonders breit, also würde wahrscheinlich schon ein kleines Schwanken ausreichen und die Statue stürzt zu Boden. Nicht unbedingt das, was die Touris sehen wollen. Das Gehirn muss also doch aktiv bleiben. „Ein bisschen wie beim Fernsehen“, meint sie. Sie beobachtet die Menschen, den Himmel, den Verkehr. Da gibt es sicher genug zu sehen. „Und wenn das auch nicht hilft, brauche ich eben Kaffee.“ Damit darf es Maria aber auch nicht übertreiben, sonst wird sie unruhig und zittrig. „Eine Tasse am Tag genügt“, sagt sie und nimmt noch einen Schluck von ihrem Café Latte. Generell versucht sie, so relaxt wie möglich zu sein. Wenn sie Probleme oder Stress hat, vergeht die Zeit viel langsamer. „Aber auch das ist bei jeder Arbeit so.“
„In einem Geschäft oder Büro könnte ich das Leben nicht mehr sehen“
Dass sie wegen eines Unfalls ein dreifach operiertes Knie hat, macht sie Sache allerdings nicht leichter. Mittlerweile muss sie deshalb öfter Pausen machen oder das Gewicht unmerklich auf das andere Bein verlagern. Ans Aufhören denkt sie zwar schon ab und zu, aber von allen anderen Optionen ist ihr die lebendige Statue auch nach 20 Jahren und mit kaputtem Knie immer noch am liebsten: „Es ist nicht so, dass ich meine Arbeit so unendlich liebe. Aber sie ist mir sehr viel lieber als alle anderen Jobs. Es gefällt mir, draußen zu sein an der frischen Luft. Kontakt mit Menschen zu haben, auch wenn ich sie nur beobachte. Ich kann das Leben beobachten! In einem Geschäft oder Büro könnte ich das Leben nicht mehr sehen. Diese Mikrowelt da drinnen würde mich einengen.“ Zwar nimmt sie hie und da auch Nebenjobs an, um sich über Wasser zu halten, wie zum Beispiel einmal über Winter in einer Parfümerie. Aber in der Regel versucht sie, vom Statuen-Dasein zu leben.

Durchschnittsgehalt? Nicht feststellbar
Ich räuspere mich kurz – jetzt wird’s indiskret: „Kannst du mir sagen“, peinliches Schweigen, „wie viel man am Tag verdient?“, frage ich Maria vorsichtig. Sie schüttelt den Kopf. Aber nicht wegen der komischen Zugeknöpftheit der meisten Menschen, sobald es ums Gehalt geht. Sondern weil die Einnahmen von Tag zu Tag immens variieren. Sie hängen vom Wetter ab, von der Menge an Menschen, von der Saison. Und natürlich von Marias Verfassung. Denn immerhin bestimmt sie ja selbst, wie lange und wie oft sie arbeitet. Bei Regen würde es zum Beispiel keinen Sinn machen, sich aufs Podest zu stellen. Dass Maria aber einigermaßen gut von ihrem unsicheren Einkommen leben kann, verdankt sie ihrer Sparsamkeit: „Wenn ich an einem Tag gut verdiene, kann ich nicht gleich losziehen und mir ein schönes Kleid davon kaufen. Denn es könnte sein, dass die nächsten vier Tage schlecht laufen. Dann könnte ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen.“
Anders als andere Statuen verlangt Maria aber kein Geld, wenn jemand ein Foto von ihr macht. Sie lebt ausschließlich von freiwilligen Spenden: „Ich kann von niemandem verlangen, dass er mich bezahlen soll. Wieviel man geben will, soll jeder selbst entscheiden. Leider gibt es aber auch andere Statuen, die betteln.“ Dass Maria sich über manche zwielichtige Konkurrenz ärgert, ist nicht zu überhören. In manchen Städten konnte sie deshalb kaum Fuß fassen: „Manche Straßenkünstler gehören eigentlich zu Bettelbanden, hinterlassen Dreck auf der Straße oder es kommt zu Streitereien. Ich kann verstehen, dass die Städte Schwierigkeiten haben zu unterscheiden, wer einen positiven touristischen Eindruck macht und wer nur Probleme bringt.“
Spanierin und Wahl-Tirolerin
In Innsbruck wurde sie aber gut aufgenommen. „Marek! Marek!“, ruft sie plötzlich einem anderen Straßenkünstler zu. „I’m here!“ Sie pfeift. Marek winkt zurück. Inzwischen erkennt Canelo seine Chance und kläfft einen vorbeigehenden Hund an. Maria lässt ihn. Die einzigen, die sich pikiert umdrehen, sind Touristinnen mit Sonnenhut und Kamera, die sich bei ihrem Wiener Schnitzel leicht gestört fühlen. Im kleinen, gemütlichen Innsbruck mit seinen historischen Häusern und hochaufragenden Alpen wirkt Maria mit ihrer immensen Energie und Lockerheit fast wie ein hell strahlender Fremdkörper.
Warum sie sich ausgerechnet hier niedergelassen hat, wundert mich ein wenig. Würde das pulsierende, hippe Barcelona nicht viel besser zu ihr passen? „Das Leben in Barcelona vermisse ich schon manchmal“, sagt Maria. „Aber die Arbeit dort fehlt mir nicht.“ Sie stand als Statue in der Nähe der Sagrada Familia und auf der Rambla, der pulsierenden Hauptschlagader der Stadt, die die Touristinnen und Touristen vom Placa de Catalunya bis zum Hafen pumpt. „Dort war es immer extrem laut: Autoverkehr von beiden Seiten, viele Touristen, immer Party. Hier in Innsbruck hat der Tourismus ein höheres Niveau. Das ist mir viel angenehmer.“ Nur selten reist sie zurück in ihre Heimatstadt. Wenn sie schon einmal Geld auf der Seite hat, nützt sie es lieber, um an Orte zu kommen, an denen sie noch nicht war.
Die Berge vor der Haustür
Bevor Maria in die Tiroler Hauptstadt kam, hat sie fast ganz Deutschland abgereist und drei Jahre in München gelebt. Ein Freund hat ihr erzählt, wie schön Innsbruck ist und dass man hier viel Sport treiben kann. Ein wichtiger Punkt für Maria, denn von Mountainbiken über Eiskunstlaufen bis zum Slacklining hat sie so ziemlich jeden Sport gemacht. „In München bin ich in meiner Freizeit immer in die Berge gegangen. Hier habe ich einfach alles direkt vor der Haustür.“ Mit dem kaputten Knie schaut Marias Freizeit heute natürlich etwas anders aus. Einfach mal unbeschwert Inlineskaten oder Slacklinen ist leider nicht mehr drin. Sie kann es sich nicht leisten, das Knie zu sehr zu belasten und am nächsten Tag nicht mehr stehen zu können.
Zusammen gegen Diebe und Po-Grapscher
Trotzdem fühlt sie sich in Innsbruck immer noch sehr wohl, das merkt man. Mit den Jahren hat sich zwischen ihr und den Geschäftsleuten der Herzog-Friedrich-Straße ein starker Zusammenhalt entwickelt. Das ist wichtig für Maria. Denn das Arbeiten auf der Straße hat auch seine Schattenseiten. Ein paar Mal hat man bereits versucht, ihr ihre Geldschatulle zu klauen. „Versucht?“, frage ich sie verwirrt. „Ich bin sehr schnell herunten von meinem Podest“, zwinkert sie mir nur zu. „Außerdem kennen mich hier sehr viele Leute. Die Einheimischen würden mir jederzeit helfen, wenn sie sehen, dass etwas nicht stimmt.“
Darunter fallen nicht nur Diebe, sondern leider auch respektlose Touristen. Erst vor Kurzem grapschte ein älterer Deutscher Maria an den Hintern. Sie hat ihn angeschrien: „Er soll lieber den Popo von seiner Frau anfassen, habe ich gesagt.“ Daraufhin beschimpfte er sie und die Mitreisenden aus seiner Touri-Gruppe lachten bloß. Im Endeffekt schritten ein paar Innsbrucker ein, die gemerkt haben, dass Maria bedrängt wird. „Sie haben ihm gesagt, dass das absolut nicht in Ordnung ist. Da habe ich wieder einmal gesehen, dass die Einheimischen mich und meine Arbeit respektieren.“Und das beruht auf Gegenseitigkeit: Auch Maria kommt zu Hilfe, wenn sie merkt, dass es in einem der umliegenden Geschäfte oder Lokale Probleme gibt. Wie zum Beispiel auch, als in der Bäckerei neben ihr jemand gehen wollte, ohne zu bezahlen. Maria stellte sich in die Tür und ließ den Zechpreller nicht vorbei, bis die Polizei da war. „Wir halten hier zusammen“, sagt sie stolz.
In Innsbruck hat sich also Maria, die Reisende, letztlich doch irgendwie niedergelassen. So ganz gesettelt hat sie sich aber noch nicht: Insgeheim träumt sie davon, nach Neuseeland zu gehen. Leider sind die Arbeitsbedingungen für sie dort aber alles andere als günstig. „Es könnte jederzeit sein, dass ich die Zelte abbreche und woanders hingehe“, lächelt sie. „Aber ich vermute nicht, dass ich aus Innsbruck weg will.“
Wenn ihr euch in der Isolation zumindest gedanklich nach Innsbruck beamen wollt, hilft ein Blick in den „kleinen Einheimischen für Innsbruck“ von Nadine Schaber. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben? Dann registriert euch bei uns und folgt der Liste Unsere Highlights in Tirol für regelmäßige Updates.