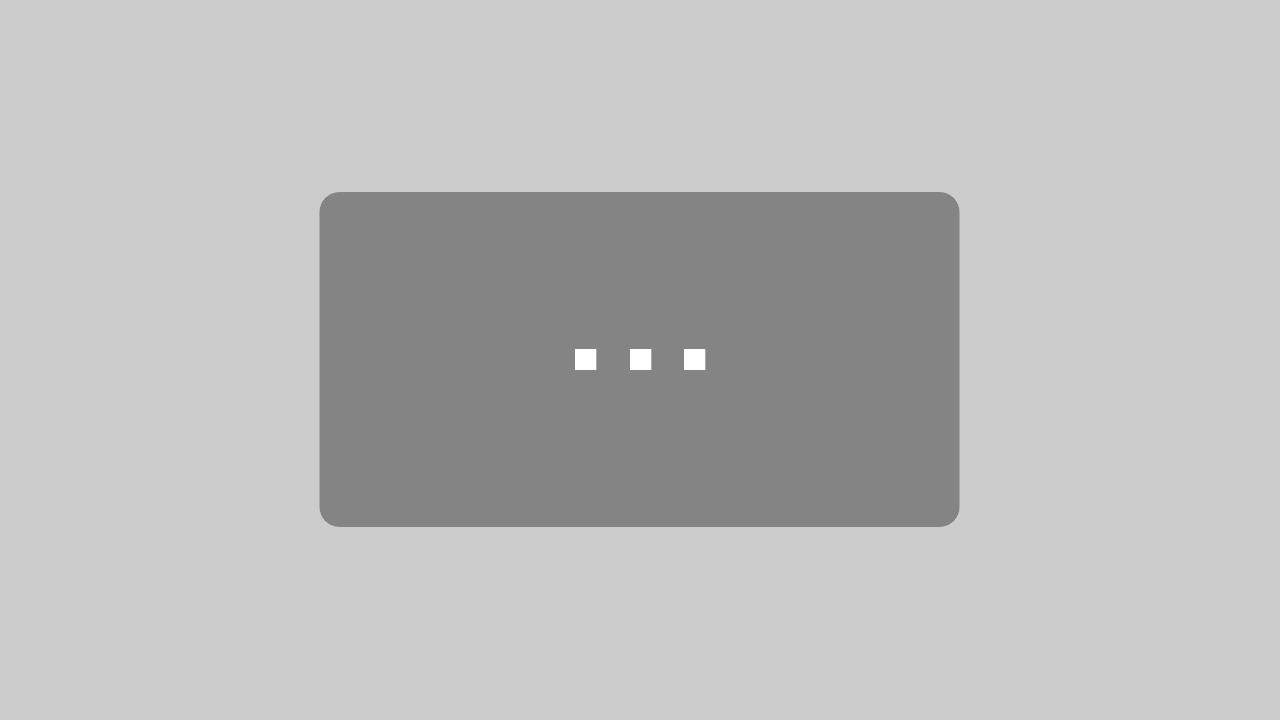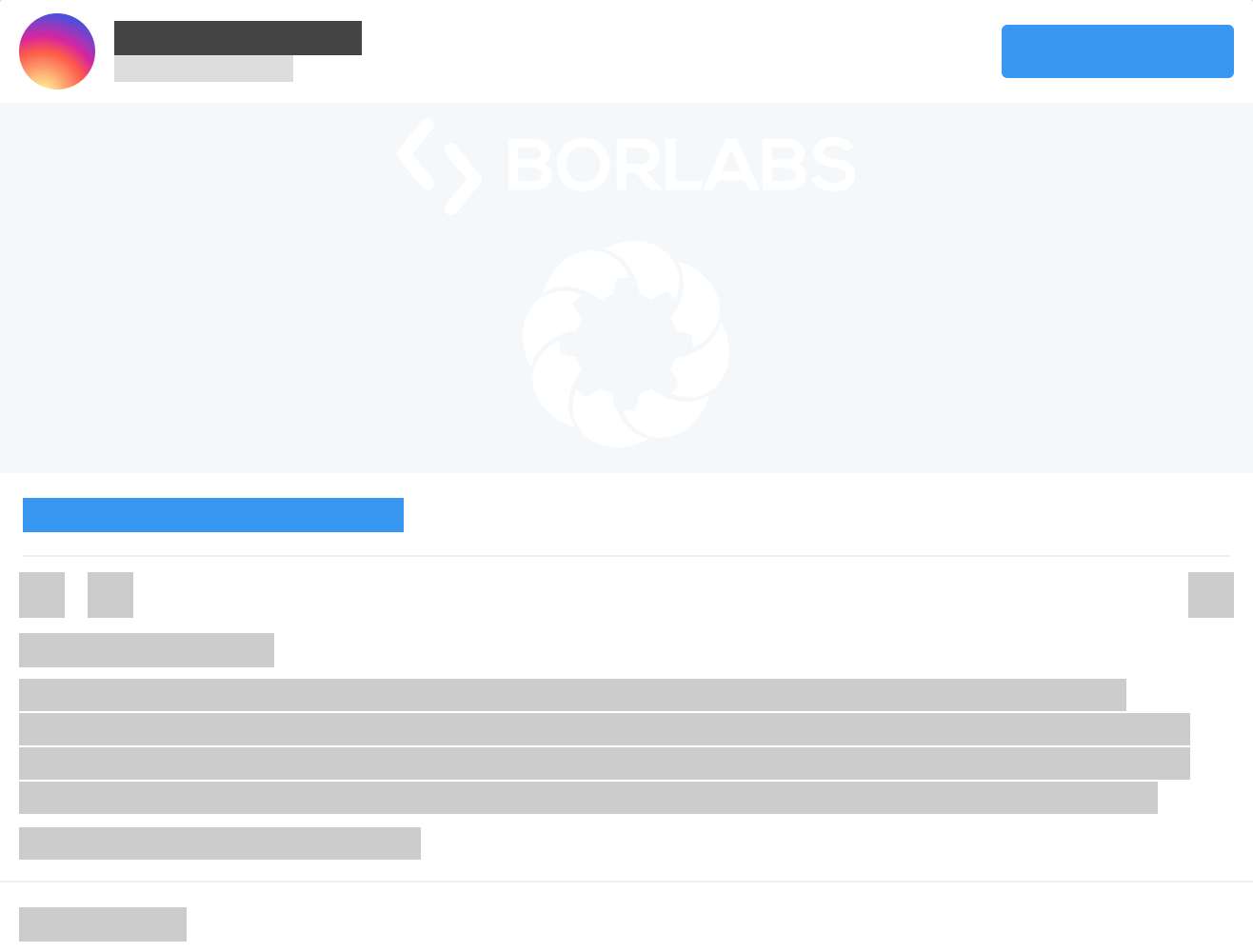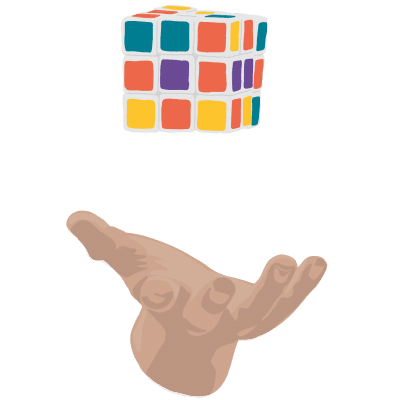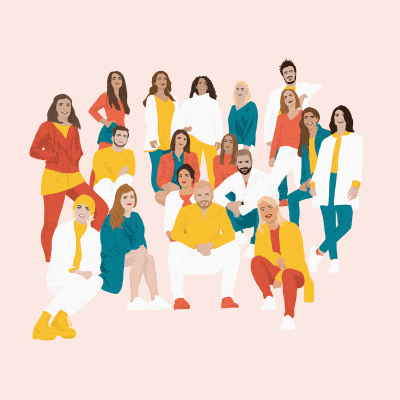Meine Jugend in der Wiener Emo-Szene


Entweder man hasste sie oder man war eine oder einer von ihnen. So einfach war das damals in den mittleren Nullerjahren mit den jugendlichen Schubladen: Warst du kein Gabba, Krocha oder soli-gebräunter Hardstyler, warst du wahrscheinlich Skater, Punk, Metaler oder irgendwas dazwischen. Und die, die es nicht geschafft haben, sich in eine dieser Schubladen zu zwängen, waren eben die Wannabes. Auch wenn man sich sonst interschubladig herzlich selten einig war, bei einer Sache war man doch derselben Meinung: Diese komischen Vögel mit den dunkel-zerrupften Haaren, dem finsteren Blick und dem Geschrei, das sie Musik nennen, sollen sich mal ganz schnell in das Nest zurückverziehen, aus dem sie gekrochen sind. Würde ich hier tatsächlich von echten Vögeln sprechen, wären das wohl die Emus. Knapp daneben. Gemeint sind natürlich die Emos. (Hier bitte sarkastisches Lachen selbst einfügen.)
Und jetzt die überraschende Wendung: Ich war eine von ihnen. Also ich habe es zumindest redlich versucht, auch wenn der Lidstrich mit dem Kohlekajal meiner Mutter nie so perfekt aussah wie bei den anderen, meine Haare nicht gleichmäßig hochtoupiert waren, sondern eher einer missglückten Dauerwelle aus den 80ern entsprachen, und ich generell einfach zu gut drauf war, um mir meine dramatische Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation wirklich abzunehmen, die für das Image der Szene damals so wichtig war. Wobei das, davon bin ich heute noch vehement überzeugt, ein gravierender Definitionsfehler ist. Emo ist nämlich lediglich die Kurzform für „emotional“, und in welche Richtung der Stimmungsbarometer ausschlagen darf, ist damit noch nicht festgelegt. Aber damit stieß ich gemeinhin auf taube Ohren und schnaubende Teenager-Genervtheit. Was soll’s, dabei war ich trotzdem irgendwie.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Myspace
Schon damals hatten wir die Möglichkeit, uns über soziale Medien zu uniformieren. Nur hieß der letzte Pigsqueel (Schweinsgeschrei, ein klassisches Element der Emo-Musik) damals nicht Instagram sondern Myspace. Ja, ich höre schon von Weitem die Protestrufe, dass Myspace nicht bloß ein Emo-Ding war. Das stimmt natürlich. Aber die Emo-Szene hat das Ganze aufs nächste Level gehoben. Das fing zunächst einmal damit an, dass man sich total kreative Namen ausdachte, die rückblickend betrachtet in etwa so klingen wie ein Arschgeweih aussieht: Zuerst hieß ich Tara-Untenstrich-Untenstrich-Untenstrich. (Als die ATV-Show aufkam, war mir das rückwirkend etwas unangenehm.) Dann waren Alliterationen plötzlich total angesagt, also nannte ich mich Viki.vicious – eine Eigenschaft, die natürlich absolut nichts gemein hatte mit meinem enervierend un-emo-mäßigen Gemüt. Und dann ist irgendjemand auf die ausgekochte Idee gekommen, sein Myspace-Profil mit einem speziellen Layout zu pimpen, das man mit unglaublich komplizierten Codes, die man irgendwo in den Untiefen des Internets fand, einrichten konnte. Wenn man es draufhatte. Ich hatte es nicht drauf. Also prangte auf meinem Profil immer irgendeine Art von Fehlermeldung.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Unterschubladen
Zusammen mit diesen programmiertechnischen Feinsinnigkeiten und den fortgeschrittenen Skills, was Haare und Make-up anging, kristallisierten sich relativ schnell große Statusunterschiede innerhalb der Szene heraus. Da gab es plötzlich die Famous-Kids, eine relativ große Gruppe besonders cooler Emos, die aus irgendeinem mysteriösen Grund jeder und jede in Wien zumindest bei ihrem Myspace-Namen kannte. Vor allem wahrscheinlich deshalb, weil man die Zugehörigkeit zur Emo-Royalty mit dem Beinamen „famous“ auf Myspace schmücken durfte. Später entwickelten sich dann die Coolsten der Coolen zu den Scene-Kids weiter, die sich vom profanen Emo-Stil der weniger Stilbewussten klar abhoben. Wie, das war wahrscheinlich nur ihnen selbst klar: Etwas weniger toupierte, schwarze Haare, etwas weniger depressive Grundeinstellung, etwas mehr echte Tattoos und Piercings. Verwirrend, ich weiß.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Dehnungsohrringe
Da haben wir auch schon die nächste Krux meiner Teenie-Rebellion: Mit 16 habe ich, wie viele andere von einem dicht „gepeckten“ Unterarm geträumt und von einer angemessenen Menge Metall im Gesicht. Dieser Traum starb mit einem süffisanten Lachen meiner Mutter, das sich mit steigender Frequenz meines Bettelns zu einem immer monotoneren „Nein“ einpendelte. Als ich daraufhin trotzig mit einem unechten Piercing-Ring, den ich mir an die Lippe hängte, herumlief, erntete ich gleich bei der ersten U-Bahn-Fahrt hämisches Gelächter von anderen aus der Szene (die ich natürlich von Myspace kannte, sie mich aber natürlich nicht). Aber ausgekocht, wie Viki.vicious nun einmal war, fand ich ein Schlupfloch: Das einzige Teil, für das ich damals kein offizielles elterliches Einverständnis brauchte, war ein Dehnungsohrring. Also besorgte ich mir eine Dehnungsschnecke und präsentierte sie meiner Mutter mit geschwellter Brust – und leider auch geschwollenem Ohrläppchen, weil ich mich beim ersten Mal verstochen hatte. Das hämische Kichern meiner Mutter tat deutlich weniger weh als das der U-Bahn-Emos, und natürlich als mein Ohrläppchen.
Generell muss ich hier der Ehrlichkeit halber anmerken, dass die Aktion bei Weitem nicht so krass war, wie sie sich damals anfühlte. Weil ich ja doch im Herzen viel zu brav für all das war, habe ich mich beim fragwürdigen Piercer meiner Wahl dreimal rückversichert, dass Ohrlöcher mit einem Durchmesser von weniger als einem Zentimeter wieder zuwachsen würden. Also wurden es bei mir nur acht Millimeter – Leben am Limit. Und selbst die sind mir bis heute als Andenken geblieben. Kämpfer haben Narben, ich habe ein etwas zu großes Ohrloch. Hoat.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Burggarten
War das Styling erst mal komplett und der betont teilnahmslose Blick ausreichend verinnerlicht, traf man sich damals im Burggarten zu etwas, das für Außenstehende wohl wie ein ziemlich schräges Massenpicknick ausgesehen haben musste. Ging man vor etwa zehn Jahren im Sommer durch den Burggarten, musste man sich durch eine Horde an schwarzen Haaren in gigantischen Sitzkreisen kämpfen, verdächtig herb riechende Rauchwolken hier, rhythmische Schreie aus knackenden Mini-Boxen da. Oder wie es die musikalisch Versierteren unter uns nannten: Screamo.
Pink Elephant und Black Devil
Wir saßen bei schönem Wetter also den lieben langen Tag zusammen im Park. Im Nachhinein eigentlich total süß, nur war uns harten Pseudo-Outlaws das damals natürlich nicht bewusst. Für uns war das Im-Park-Sitzen und dabei „g’fährlich“ ausschauen, wie meine Mutter es oft scherzhaft nannte, der ultimative Akt der Revolte. Dazu gehörten natürlich auch Ersterfahrungen, die man tunlichst vor den Eltern verheimlichen musste. In meinem Fall: Tschick. Aber natürlich rauchten wir damals nicht einfach profane weiße Glimmstängel. Nein, selbst beim Verpesten unserer Lunge achteten wir auf den richtigen Style. Entweder zogen an etwas, das sich zwar verheißungsvoll Black Devils nannte, aber im Endeffekt nur schwarze Zigaretten mit Schoko-Geschmack waren.
Oder man griff zur fröhlicheren Variante und rauchte Pink Elephants, also rosafarbene Zigos mit Vanille-Flavour. Aber wie das eben so ist, wenn man sich als Jugendliche einbildet, dass einem niemand auf die Schliche kommt, kam mir meine Mutter natürlich ziemlich bald auf die Schliche. Vielleicht lag es an den Unmengen an Kaugummis, die ich in meiner Tasche hortete, vielleicht auch an der verdächtig intensiven Deo- und Parfüm-Wolke, die mich jedes Mal umgab, wenn ich nach Hause kam. Jedenfalls musste ich der bestürzten Vermutung meiner Mutter, Nikotinstaberln, die pinker Elefant heißen, müssen irgendetwas mit halluzinogenen Drogen zu tun haben, kleinlaut entgegnen: „Nein, Mama, das sind nur leichte Zigaretten, die nach Vanille schmecken.“ Ich glaube, ab diesem Zeitpunkt fand mich nicht einmal meine eigene Mutter mehr cool.
Hippie-Café
Wenn uns das Draußensein im Burggarten irgendwann doch anödete, pilgerten wir in dunklen Scharen die Mariahilfer Straße hinauf zum Hippie-Café. Manche von uns machten davor noch einen kurzen Abstecher ins Generali-Center oder zum „Emo-Mäci“, also zur McDonald’s-Filiale bei der U3-Station Zieglergasse. Die ganz Harten schmuggelten sogar ihre grindigen PET-Flaschen mit Selbstgemischtem auf die Toiletten und machten dort ein bisschen Party. Warum, wusste eigentlich keiner so genau. Rebellisch war es. Das war wichtig.
Im Hippie-Café gab es jedenfalls alles, was man von einem Laden mit dem Namen Hippie-Café erwarten könnte: bunte Tücher an den Wänden, Pizza, die der leicht weggetretene Besitzer so unwillig belegte, dass sie schon wieder Kult war, spärliche Beleuchtung, und Shishas in ihrem natürlichen Habitat. Lange bevor die gut ausgeleuchteten Shisha-Bars mit Standard-Ledersitzecken und Spielautomaten im Eck in Wien aus dem Boden sprossen, war „Gemma shishen?“ für uns fast schon so etwas wie eine Parole. Und schon saßen wir in einem dicken Schwall aus süßlichem Dampf im Fastdunklen und fühlten uns, das kann man gar nicht weniger pathetisch formulieren, irgendwie frei. Und hart. Vor allem deshalb, weil sich mit der Zeit das Gerücht breit machte, dass Polizei-Razzien das Café immer wieder in helle Aufruhr versetzten, von denen aber jeder und jede von uns komischer Weise nur im Konjunktiv berichten konnte. Jede Jugend braucht Legenden. Das war unsere.
Korrektes Styling
Jede Szene hatte eben ihre ganz eigenen Rituale – die Gabba, Krocha und Co. gingen ins Solarium, die Emo-Kids lungerten in Parks und Shisha-Bars rum und magazinierten sich in Geschäften wie Rattelsnake, Full Power oder King Pin für das Wochenende auf. Ein T-Shirt von der Szene-Marke Famous, Stars and Stripes für 30 Euro konnte ich mir im Monat gerade so leisten, dazu vielleicht sogar noch ein paar Buttons für meine grüne Army-Tasche, wenn ich mein Taschengeld bis dahin beieinander halten konnte. Längst zum Standard-Repertoire gehörten natürlich auch Nietengürtel, absichtlich verdreckte Converse, der Standard-Haarschnitt vom Frisör Youngstyle, Schachbrettmuster-Vans und politisch nicht weiter hinterfragte PLO-Schals.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Festivalarmbänder
Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle das Bindeglied mehrerer Alternativo-Szenen hervorheben, die tragbaren Trophäen auf unserem Unterarm, die mühsam erquengelten Eintrittspässe in die mehrtägige Aushebelung des Spießertums: die Festivalbänder! Das hatten Emos, Metaler, Punks, Indie-Rocker und wie sie sich nicht alle nannten zur Abwechslung mal gemein. Man war auf dem einen oder anderen großen Festival und brüstete sich das restliche Jahr über damit, dass man überlebt hat – und die Eltern davon überzeugen konnte, dass das Dranlassen des Bandels „ur nicht unhygienisch“ sei und das „alle anderen auch so machen, boah“. Sie waren quasi die Pfadfinder-Abzeichen der Subkulturen. Und wie das mit Abzeichen eben so ist: Mit großer Anzahl kommt große Achtung. Jenen, die es geschafft haben, sich den kompletten Unterarm bis zur Unkenntlichkeit zuzupflastern, galt unser absoluter Respekt. Sie hatten so ziemlich alles erreicht, was wir uns vom nächsten Sommer erwarteten. Die Veteranen der Konzertwelt.
Hörsturz
Was für uns im Großen in den Sommermonaten Mainstream-Festivals wie Nova Rock oder Frequency waren, war im Kleinen jedes Monat das Hörsturz. Die ultimative Party für alle, die ähnlich „g’fährlich“ aussahen wie wir. Alle Styling-Ambitionen, jede monetäre Disziplin richtete sich auf diesen einen Samstag im Monat. Und dann liefen meist Tage davor schon die Vorbereitungen auf Hochtouren: Wer wird behaupten, bei wem zu übernachten? Oder in meinem Fall: Wessen Mama kann uns diesmal um ein Uhr Früh unauffällig abholen, wenn wir so tun, als wären wir von einem Eristoff Ice so betrunken, dass wir leider „frühzeitig abreißen“ müssen. Ja, klar. Doch bevor es so weit war, musste man sich erst einmal sorgfältig aufbrezeln. Was ich mittlerweile mit einer längeren Dusche und einem noch längeren unmotivierten Blick in den Spiegel hinter mich bringe, war damals ein Aufwand mehrerer Stunden. Zuerst musste geklärt werden, welche Leopardenmuster-Strumpfhose zu welcher zerrissenen Hose passt, dann vergingen wir uns so lange an unseren Haaren, bis sie zu einem einzigen Wattebausch verunstaltet waren, und schließlich noch die schwarzen Ringe um die Augen, die verdammt wenig von künstlerischem Know-how hatten, dafür verdammt viel von brünftigem Pandabären. Das Ganze war so ein Spektakel, dass ab und zu sogar meine Großeltern auf Besuch kamen, um meine Freundinnen und mich in unseren Outfits zu fotografieren. „Des glaubt uns kana!“ Und wir posierten auch noch stolz.
Waren wir endlich amtlich verwordackelt, pilgerten wir alle zusammen zur Arena. Natürlich schon um 21 Uhr, damals war es noch wichtig, möglichst früh dran zu sein, um möglichst viel aus dem Abend rauszuholen, bis die Eltern vorfuhren. Also entweihten wir die altehrwürdigen Hallen des Schlachthofs, den Generationen vor uns in echter Rebellion besetzten, mit unseren absichtlich zerschlissenen Outfits, pogten und moshten zu Mr-Bightside von The Killers, I Write Sins Not Tragedies von Panic! At The Disco oder Blood Sugar von Pendulum aus der Büchse und nippten an unseren alkoholischen Softdrinks. Irgendwann kamen dann noch andere Veranstaltungen wie das Ai:Rock in der Area 51 in einem leerstehenden Fabriksgebäude in Simmering dazu, und als das Hörsturz selbst schließlich ins Exx im 22. Bezirk verlegt wurde, dämmerte uns allmählich, dass diese Ära langsam aber sicher dem Ende zusteuert. Dass unsere Jugend wohl doch nicht so ewig dauern würde, wie es sich anfühlte. Dass uns wohl bald zum letzten Mal unsere Nietengürtel um die Knie schlackern und unsere Haare im Seitenscheitel über beide Augen hängen würden. Und dass die Zeilen aus dem Song Teenagers von My Chemical Romance irgendwann auch auf uns zutreffen würden: „These teenagers scare the living shit out of me.“
Darf’s noch ein bisschen mehr Nostalgie sein? Wir haben uns ein paar Dinge für euch, die jeder und jede kennt, wenn man in Wien aufgewachsen ist. Außerdem werfen wir auch einen Blick zurück bis in die 90er.
(c) Beitragsbild | Pixabay