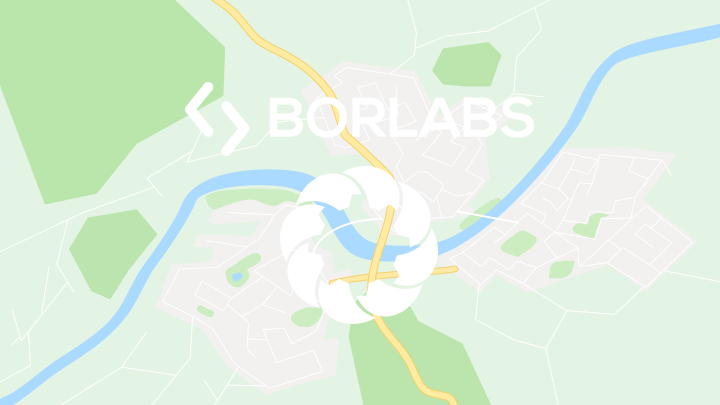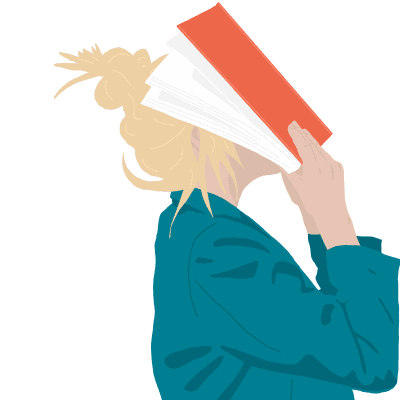Sagenspaziergang durch die Wiener Innenstadt
In Wien findet man einige Orte, um die sich Sagen ranken. Kommt mit auf einen Spaziergang durch das Zentrum Wiens zu einigen Schauplätzen von Wiener Sagen, frischt euer Sagenwissen auf und lest, was wohl hinter ihnen steckt.

Wir nehmen euch mit auf einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt, der euch zu einigen Orten führt, um die sich Sagen ranken. Es geht von der Praterstraße über den Donaukanal, durch die Innere Stadt und schließlich in den Stadtpark. Die reine Gehzeit beträgt etwa eine Stunde. Also, packt euch warm ein, nehmt eine Thermoskanne mit Tee mit oder holt euch unterwegs Punsch zum Mitnehmen oder einen Kaffee und los geht’s!
Schabdenrüssel | Czerningasse 7a, 1020 | Rabensteig 8, 1010
Der Sagenspaziergang beginnt in der Czerningasse in der Leopoldstadt. Die Czerningasse hat früher Schabdenrüsselgasse geheißen, nach einer Wiener Sage. Streng genommen müsste dieser Spaziergang wohl im 1. Bezirk beginnen, am Rabensteig. Denn dort kaufte der Salzhändler Michel Schabenrüssel im 16. Jahrhundert einen Häuserkomplex. 30 Jahre später verkaufte er die Immobilien an den damaligen Wiener Bürgermeister Matthias Brunnhofer, der an ihrer Stelle ein Doppelhaus errichten ließ. Die Gastwirtschaft „Zum Schabenrüssel“ und ein Hausschild an der Fassade erinnerten noch an den Voreigentümer mit dem seltsamen Namen, bis das Haus um 1900 abgerissen wurde. Außergewöhnliche Namen inspirierten immer wieder Sagen. Ab dem 19. Jahrhundert erzählte man sich in Wien die Sage von „Schab den Rüssel“. Am Rabensteig erinnert nichts mehr an die Legende oder das Haus. Aber in der Czerningasse prangt an der Hausfassade der Nummer 7a ein Wandbild, unter dem geschrieben steht: „Vor vielen Jahren stand unweit dieser Stelle das Haus zum Schabdenrüssel, benannt nach einer Alt-Wiener Sage.“
Der Sage nach war ein Bettler sehr verzweifelt. Tag für Tag saß er auf den Stufen der Peterskirche, aber die Menschen gaben nur wenig Almosen. Eines Tages begegnete ihm der Teufel in Form eines hinkenden Männleins und bot ihm eine magische Raspel an. Führte man die Raspel an den Mund und sprach „Schab den Rüssel!“, fiel ein Goldstück von den Lippen. Man konnte die Raspel auch gegen Menschen einsetzen, die einem zuwider waren. Durch dieselben drei Wörter würde die Raspel der verwunschenen Person übers Gesicht schaben. Der Teufel würde dem Bettler die Raspel überlassen, wenn dieser ihm seine Seele verspräche. Nach sieben Jahren würde der Teufel sie holen kommen. Der Bettler ging den Handel ein: „Lieber sieben Jahre in Saus und Braus leben als ein ganzes Leben als armer Hund!“, dachte er sich.
Der Mann ließ sich erst vom Schneider ein feines Gewand machen, mietete sich dann im besten Gasthof Wiens ein und aß dort ausgiebig. Auf seinem Zimmer machte er sich an die Arbeit, Gold zu produzieren. Mit jedem Goldstück, das von seinen Lippen fiel, ging aber auch immer ein Stück Haut mit. Das bemerkte der Mann in seinem Eifer erst, als ihm Blut auf sein neues Gewand tropfte. Irgendwann waren seine Lippen schon ganz verkrustet und eitrig. Aber er hatte zu viel vor, um sich darüber Gedanken zu machen. Mit seinem Reichtum konnte er sich ein schönes Haus kaufen, Dienstboten anstellen und sein Leben in vollen Zügen genießen. Er saß oft im Wirtshaus und lud andere großzügig ein. Seine Lippen waren inzwischen ganz verunstaltet. Einer verspottete ihn einmal deswegen. Da holte der Mann die Raspel hervor, sprach die Zauberworte und die Raspel fuhr dem Spötter fest über die Mund. Der Mann mit der Raspel wurde von da an „Schabdenrüssel“ genannt.
Als eines Abends der Teufel vor Schabdenrüssel stand und dessen Seele einsammeln wollte, setzte dieser die Raspel gegen den Teufel ein. Die Raspel fuhr dem Teufel fest übers Gesicht, wodurch dieser vor Schmerzen aufheulte. Der Teufel hatte nämlich vor sieben Jahren darauf vergessen, sich selbst von dem Zauber auszunehmen. Schabdenrüssel hatte nun seinerseits ein Angebot: Er würde den Teufel von der Raspel befreien, wenn er auf seine Seele verzichten und sofort in die Hölle zurück fahren würde. Der Teufel willigte ein und Schabdenrüssel lebte noch lange reich und glücklich und freute sich, dass er den Teufel ausgetrickst hatte.

Die Praterstraße entlang geht es stadteinwärts. Am Fuß der Praterstraße überquert ihr einen charmanten Platz, auf dem sich ein Lokal ans nächste reiht. Über die Taborbrücke und damit über den Donaukanal spaziert ihr weiter zum Schwedenplatz und zum Rabensteig, wo einst das Schabenrüsselhaus stand. Nun geht die Seitenstettengasse hinauf und vorbei am Stadttempel der jüdischen Gemeinde Wiens. Ihr seid am nächsten Sagenort angekommen, dem ehemaligen Katzensteig. Die Kirche hier oben ist übrigens die Ruprechtskirche. Sie ist die älteste in ihrer Grundsubstanz noch bestehende Kirche der Stadt.
Katzensteig | Seitenstettengasse, 1010
Ein Teil der heutigen Seitenstettengasse hieß lange Katzensteig. Der Name leitet sich von einem Teil der Stadtbefestigung ab, einem gemauerten kleinen Aufbau auf einer Bastei. Der Fachbegriff dafür ist „Kavalier“, aber im Volksmund hat diese Befestigung den Namen „Katze“ bekommen – vielleicht, weil sie auf der Bastei saß, wie eine Katze auf einer Mauer. Aber auch eine Wiener Sage bemüht sich um die Erklärung des Namens.

Die Sage von der gespenstischen Katze erzählt von einem teuflischen Plan, der gehörig schief ging. Ein Hausbesitzer am Katzensteig soll ein besonderer Wüstling gewesen sein. Seine Ehefrau ertrug die Ausschweifungen ihres Mannes still. Irgendwann verliebte sich der Mann in eine Nachbarin. Um zusammen sein zu können, planten die Verliebten, die Gattin des Mannes zu vergiften. Sie mischten Gift in die Suppe der Ehefrau, aber durch eine Verwechslung aß stattdessen die Nachbarin die vergiftete Speise. Das Gift soll das Gehirn der Nachbarin so stark beschädigt haben, dass sie dachte, sie sei eine Katze. Auf allen Vieren lief sie durch das ganze Haus und miaute, schrie und fauchte. In ihrem Wahn wurde sie immer wilder. Als sie einmal auf das Dach kletterte und von Giebel zu Giebel sprang, stürzte sie ab und brach sich das Genick. Seitdem soll sie als weiße, gespenstische Katze die Gegend heimgesucht haben.
Biegt nun in die Sterngasse ab, spaziert vorbei am englischen Buchgeschäft Shakespeare & Company, überquert den Kreisverkehr und geht weiter bis zum Ende der Sterngasse. Dort geht ihr links die Stufen zur Salvatorgasse hinauf. Vor euch liegt nun die Hinterseite des Alten Rathauses von Wien. Hier befindet sich unter anderem das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes. Geht nach rechts weiter bis zur nächsten Gasse, Stoß im Himmel.
Stoß im Himmel | Stoß im Himmel 3, 1010
Den Namen „Stoß im Himmel“ trägt diese Gasse seit Ende des 18. Jahrhunderts. Er geht zurück auf Hans Stosanhiml, der ehemals das Haus Nummer 3 besaß. Auch dieser ungewöhnliche Name inspirierte eine Sage. Im Haus Nummer 3 soll einmal eine eitle und reiche Frau gelebt haben, die vollkommen dem Materiellen verfallen war. Haushalt und regelmäßige Kirchenbesuche vernachlässigte sie. Lieber gab sie all ihr Geld für prächtige Kleider aus. Eines Tages spazierte sie an einem Marienbild vorbei und spottete, die Muttergottes solle doch versuchen, sich mit ihrer Kleiderpracht zu messen. Die Heilige Jungfrau wendete sich enttäuscht ab.
In der folgenden Nacht klopfte eine alte Bettlerin an die Tür der eitlen Frau. Die unbarmherzige Frau wollte die Alte gleich verscheuchen. Doch anstatt zu gehen, zeigte die Besucherin der Frau, was sie in ihrem Korb hatte: ein umwerfendes Kleid aus Gold und Samt, einen dazu passenden glitzernden Gürtel und feine Schuhe. Die eitle Frau wollte das fürstliche Gewand unbedingt haben, hatte aber gerade all ihr Geld für andere Kleider ausgegeben. Sie flehte die Alte an, ihr das Kleid zu geben, koste es, was es wolle.
Die Bettlerin machte einen Vorschlag: Sie würde der Frau das prächtige Gewand für drei Tage überlassen. Im Gegenzug müsste sie ihr zu Mitternacht des dritten Tages das geben, was vom Kleid bedeckt war. Die eitle Frau verstand nicht recht, was die Alte damit meinte und ging davon aus, dass sie wirres Zeug sprach. Sie willigte ein. Drei Tage lang genoss die Frau die Bewunderung aller, denen sie begegnete. Kurz vor Mitternacht des dritten Tages dachte sie noch einmal an die Worte der Alten und realisierte, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Sie versuchte verzweifelt, das Kleid abzulegen, aber es gelang ihr nicht. Sie versuchte, das Kleid in Fetzen zu reißen, aber der Stoff gab nicht nach. Jammernd lief sie in ihrem Zimmer auf und ab.
Um Mitternacht klopfte es an der Tür. Die zerlumpte Alte trat ein und zeigte ihr wahres Gesicht: Es war der Teufel. Er war gekommen, um die Frau zu holen. Das Kleid ging in Höllenflammen auf, die die verzweifelte Frau umschlungen. Aber als der Teufel seine Klauen nach der Frau ausstreckte, schlug ihm ein kraftvoller Stoß entgegen, der das brennende Kleid abfallen ließ. Unter dem Kleid hatte die Frau ein Bild der Heiligen Barbara getragen, die ihr nun beistand. Die Heilige stieß nicht nur den Teufel weg. Sondern durch die wundersame Rettung gab sie der vormaligen Sünderin auch einen Stoß in den Himmel, also zum Glauben und zu einem frommen Leben. Die Frau tat Buße und ging ins Kloster, wo sie ein musterhaftes Leben führte.

Übrigens verlief in dieser Gegend die Mauer der ersten sogenannten Judenstadt in Wien. Die erste jüdische Gemeinde in Wien entstand rund um den heutigen Judenplatz. Im Zuge eines großen Pogroms 1420/1421, Wiener Geserah, wurde die Gemeinde zerschlagen. Ihre Angehörigen wurden zwangsgetauft, gefoltert, vertrieben oder verbrannt. Im Zweiten Weltkrieg, zwischen 1942 und 1945, befand sich am Stoß im Himmel ein Lager für italienische Zwangsarbeiter*innen.
Beim Third-Wave-Coffee-Lokal Kaffein an genau dieser Stelle bekommt ihr übrigens köstlichen Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen. Weiter geht’s, die Salvatorgasse hinunter, vorbei an der Kirche Maria am Gestade und die Stufen hinunter zum Tiefen Graben. Von dort aus geht ihr am berühmt-berüchtigten Stundenhotel Orient vorbei in Richtung Freyung. Dass der Tiefe Graben gewissermaßen eine Senke zwischen Freyung und Am Hof ist, kommt daher, dass hier früher der Ottakringer Bach und später der Alserbach zum heutigen Donaukanal hinunterflossen. Um das Areal um den Bach herum bebauen zu können, wurde das Bachbett trockengelegt. Man bemühte sich darum, den Niveauunterschied anzugleichen, aber ein gewisses Gefälle zum ehemaligen Bachlauf blieb erhalten. Der Übergang von der Freyung zum Platz Am Hof heißt Heidenschuss und ist Schauplatz der nächsten Sage.
Heidenschuss | 1010
Im Bereich des heutigen Heidenschuss stand einmal ein Stadttor, das in Richtung Schottenkloster aus der Stadt führte. 1529 belagerten die Osmanen zum ersten Mal Wien. Zu dieser Zeit soll sich die nächste Sage ereignet haben.
Die Osmanen lagen schon wochenlang vor den Toren Wiens. Aber bisher hatten sie es nicht geschafft, die Stadtmauern zu überwinden. Ein Überläufer meldete dem Stadtkommandanten, dass die Belagerer es nun unterirdisch versuchen wollten. Angeblich machten sie sich daran, sich einen Weg unter der Mauer durch in die Stadt zu bahnen. Daraufhin wurden alle Besitzer von Häusern nahe der Stadtmauer angewiesen, mit Wasser gefüllte Gefäße im Keller aufzustellen. Diese sollten ständig beobachtet werden. Bemerkte jemand, dass die Wasseroberfläche zitterte, sollte man das sofort melden. Außerdem wurden Trommeln aufgestellt, auf deren Membran kleine Würfel gelegt wurden. Bewegten sich diese über die Membran, war das ein weiterer Hinweis darauf, dass in der Umgebung gegraben wurde. Eines Nachts war ein Bäckergeselle in einem Haus nahe der Stadtmauer dabei, Brot zu backen. Da bemerkte er, dass die Würfel auf der Trommel zitterten. Er presste sein Ohr an den Boden und meinte, Stimmen und Pochen von Werkzeugen zu hören. Sofort informierte der Junge den Stadtkommandanten. Daraufhin begann man, den Belagerern entgegenzugraben. So gelang ein Überraschungsangriff und der Stollen wurde wieder zugeschüttet.
Die Ortsbezeichnung Heidenschuss ist allerdings schon seit dem 14. Jahrhundert nachgewiesen. Damals prangte am Haus Heidenschuss 3 ein Schild auf dem, in Hochdeutsch übersetzt, stand: „Wo der Heide schießt“. An der Ecke Heidenschuss/Strauchgasse ist eine Reiterstatue zu sehen: ein Osmane mit Krummsäbel. Die Figur wurde in dieser Form erst Mitte des 19. Jahrhunderts angebracht, im Zuge von Umbauarbeiten. Davor befand sich an dieser Stelle eine Reiterfigur mit Pfeil und Bogen, vermutlich ein Sarazene.

Nun wendet euch wieder der Freyung zu und spaziert, vorbei am Austria Forum und am Stadtcafé, in Richtung Palais Ferstel. Der historistische Bau wurde im Stil der italienischen Renaissance errichtet. In der Passage des Palais findet ihr nicht nur erstklassigen Café und köstliche heiße Schokolade bei Caffè Couture, feine Schokolade bei Xocolat oder französische Feinkost bei Beaulieu, sondern auch den Donaunixenbrunnen. Übrigens ist die Bezeichnung Palais für dieses Gebäude nicht historisch, denn es war nie eine Adelsresidenz, sondern wurde als Börse- und Nationalbankgebäude gebaut.
Donauweibchen | Palais Ferstel, Freyung 2/ Herrengasse 14, 1010
Der Donaunixenbrunnen ist einer von zwei öffentlich zugänglichen Brunnen, die von der Sage um das Donauweibchen inspiriert wurden. Er wurde vom Architekten des Palais Ferstel, Heinrich von Ferstel, entworfen. Der Donaunixenbrunnen steht im sogenannten Basarhof. Das Bassin wurde aus Marmor gehauen und die Figuren aus Bronze gegossen.
Als Wien noch eine kleine Stadt war, lebten einfache Fischersleute am Ufer der damals noch wilden Donau. Der Sage nach lebte in einem dieser Fischerdörfer bei Wien ein alter Fischer mit seinem Sohn. Eines Abends saßen die beiden beim Feuer beisammen. Der Vater erzählte seinem Sohn vom Donaufürsten, der auf dem Grund des Stromes in einem Palast lebte. In diesem Palast, so erzählte der Vater, hielt der Donaufürst die Seelen von Ertrunkenen gefangen. Und wer dem schönen Gesang seiner Töchter, der Wassernixen, hinaus aufs Wasser folgte, käme nie wieder zurück. Der Sohn glaubte die Geschichten nicht. Aber auf einmal stand ein zierliches, wunderschönes Mädchen in der Haustür. Sie trug wallende weiße Kleider und ihre schwarzen Haare waren mit Wasserlilien geschmückt. Die beiden Fischer erschraken schrecklich, aber die Wassernixe beruhigte sie. Sie war gekommen, um die beiden Fischer zu warnen, dass mit dem bevorstehenden Tauwetter Hochwasser drohten und das Dorf in Gefahr sei. Sofort verschwand das Donauweibchen wieder. Die beiden Männer warnten das gesamte Dorf. Alle packten ihre Sachen und zogen weiter ins Land hinein. Als wenige Tage später das Eis zu schmelzen begann, flutete das Wasser der Donau das gesamte Dorf.
Als das Wasser zurückging, kehrten alle zurück und bauten das Dorf wieder auf. Der junge Fischer aber war seit der Begegnung mit dem Donauweibchen nicht mehr derselbe. Er war ganz verträumt und ruderte voller Sehnsucht nach dem schönen Mädchen immer wieder hinaus aufs Wasser, immer weiter und weiter. Eines Tages kam der junge Fischer von seiner Fahrt nicht mehr zurück. Die ganze Nacht wartete der Vater auf den Sohn. Am nächsten Morgen wurde ein leeres Boot von den Wellen der Donau ans Ufer getragen. Der Vater wusste, dass das Donauweibchen seinen Sohn geholt hatte. Seit diesem Tag soll niemand jemals mehr das Donauweibchen gesehen haben.

Das Donauweibchen ziert auch einen Brunnen im Stadtpark. Aber zu diesem Sagenort kommen wir dann noch am Schluss dieses Spaziergangs.
Durch die Passage geht es zur Herrengasse und dann nach links in Richtung Herrengassen-Hochhaus. Vor dem Hochhaus biegt ihr links ab und spaziert über den Haarhof in die Naglergasse. Über die Naglergasse erreicht ihr den Graben, wo es derzeit eine der prächtigsten Weihnachtsbeleuchtungen Wiens zu bestaunen. Vorbei an der Pestsäule geht es Richtung Stephansplatz. Der nächste sagenumwobene Ort befindet sich am Eck zur Kärntner Straße, an der Fassade des Palais Equitable.
Stock im Eisen | Stock-im-Eisen-Platz 1, 1010
Es gibt mehrere Versionen der Legende über diesen Baumstamm, der voller eiserner Nägel ist und von einem Eisenring umschlungen wird. Eine Erzählung über den sogenannten Stock im Eisen geht so.
Ein Schlosserlehrling wurde von seinem Meister aus der Stadt geschickt, um etwas zu besorgen. Der Junge vergaß vollkommen auf die Zeit und als er wieder am Stadttor ankam, war dieses bereits verschlossen. Um hineinzukommen, hätte er dem Torwart einen sogenannten Sperrkreuzer zahlen müssen. Außerdem drohten ihm Schläge von seinem Meister, weil er sich verspätet hatte. „Des Teufels möchte ich sein, wenn ich nur in die Stadt könnte!“, rief der Lehrling. Prompt erschien der Teufel. Er versprach ihm einen Sperrkreuzer, dass der Meister ihn nicht schlagen würde und dass der Lehrling außerdem eine erfolgreiche Schlosserkarriere haben würde. Im Gegenzug dazu trug der Teufel dem Jungen auf, dass er sein gesamtes Leben lang keine einzige Sonntagsmesse versäumen dürfte.
Der Lehrling ging den Vertrag ein, der vermeintlich leicht einzuhalten war. Eines Tages kam der Teufel in die Schlosserwerkstatt, in der der Lehrling und sein Meister arbeiteten. Er bestellte einen Eisenring für eine Eiche im Wienerwald, der mit einem Schloss versperrt sein sollte. Das Schloss sollte so kunstfertig sein, dass niemand es öffnen konnte. Als dem Lehrling dieses Kunststück gelang, machte der Meister ihn zum Gesellen. Der Teufel legte den Eisenring um die Eiche und verschloss ihn, wodurch der Baum den Namen Stock im Eisen erhielt, und nahm den zugehörigen Schlüssel mit.
Der Schlossergeselle ging auf Reisen. Als er zurück nach Wien kam, hörte er von einem Wettbewerb: Wer es zustande brachte, das Schloss von der Eiche zu entfernen, würd vom Stadtrat das Meisterrecht verliehen bekommen. Der Teufel hatte einst den einzigen passenden Schlüssel mitgenommen. Ader Geselle machte sich daran, den Schlüssel nachzuschmieden. Doch jedes Mal, wenn er den Schlüssel zum Schweißen ins Feuer legte, drehte der Teufel den Schlüsselbart um. Damit war der Schlüssel unbrauchbar. Der Schlossergeselle erkannte, was geschah und wandte einen Trick an. Er schob den Schlüssel mit verkehrtem Bart in den Ofen hinein und wieder wurde der Bart umgekehrt, sodass der Schlüssel funktionstüchtig aus dem Feuer kam.

So konnte das Schloss an der Eiche geöffnet werden und der Geselle wurde zum Bürger und zum Meister gemacht. Jubelnd schlug der frischgebackene Meister zum Andenken einen großen Nagel in den Baumstamm. Er warf den Schlüssel vor lauter Freude in die Luft, aber zum Erstaunen aller Anwesenden fiel der Schlüssel nie wieder zu Boden.
Der junge Schlossermeister wurde immer erfolgreicher und vermögender. Stets achtete er penibel darauf, die Sonntagsmesse nicht zu verpassen. Aber der Teufel sorgte dafür, dass er spielsüchtig wurde. Als der Meister eines Sonntags vor der Messe in einem Gasthof auf der Tuchlauben spielte und trank, schlug es auf einmal 12 Uhr. Erschrocken sprang der betrunkene Meister auf und bemühte sich, zum Stephansdom zu laufen. Aber als der Schlosser am Domtor ankam, hatte der Priester den Segen bereits gespendet und der Schlosser wurde vom Teufel geholt. Es wurde aber zum Brauch, dass jeder Schlossergeselle, der nach Wien kam, einen Nagel in den Baumstamm schlug.
Wer sich fragt, ob es sich dabei um einen echten Holzstamm handelt: Ja, er ist echt. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Eiche. 1975 wurde das Holz wissenschaftlich untersucht. Man fand heraus, dass der etwa zwei Meter hohe Stamm von einer Zwiesel-Fichte stammt. Sie hat um 1400 zu wachsen begonnen und wurde etwa 40 Jahre später gefällt. Woher der Brauch, Nägel in diesen Baumstamm zu schlagen, tatsächlich kommt, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Der Zunftbrauch durchreisender Schmiedegesellen, sich auf der Walz mit Nägeln zu verewigen, entstand erst im 18. Jahrhundert. Aber schon als der Baum noch lebte wurden Nägel in die Vorderseite des Stammes geschlagen und später noch bis ins 19. Jahrhundert hinein. Auf dem Stock-im-Eisen-Platz ist der Stamm ab dem 16. Jahrhundert nachweisbar. Ende des 19. Jahrhunderts wurde er an seinem heutigen Platz angebracht.
Der nächste Sagenort befindet sich im Stephansdom. Er ist aufgrund der Messen zu eingeschränkten Besichtigungszeiten zugänglich, die online ausgeschrieben sind.
Dienstbotenmadonna | Stephansdom, 1010
Die Sage um diese Marienstatue stammt aus dem 17. Jahrhundert. Eine reiche adlige Dame soll einst ihre Dienstmagd des Diebstahls bezichtigt haben, weil eine wertvolle Kette fehlte. In anderen Versionen der Erzählung ist es eine Brosche oder ein Ring. Die Magd war erst seit Kurzem im Haus. Das machte das Mädchen in den Augen ihrer Herrin verdächtig. Die gnadenlose Frau schrie ihre Magd an und bedrohte sie mit einer Gerte. Das Mädchen lief davon, warf sich vor die Füße der Muttergottesstatue in der Hauskapelle und bat sie um Hilfe. Die Dame des Hauses hatte schon die Stadtwache gerufen. Die Wachtmänner durchsuchten alle Kästchen und Truhen der Dienerschaft. Das wertvolle Schmuckstück wurde beim Kutscher gefunden. Dieser gestand, es eingesteckt zu haben, als die Herrin es einmal beim Aussteigen aus der Kutsche verloren hatte. Er wurde sofort festgenommen. In einer Version der Sage bereut die Herrin sehr, ihrer Dienstmagd Unrecht getan zu haben und schenkt deshalb die Muttergottesstatue der Wiener Stephanskirche. In einer anderen Version kann die Herrin den Anblick der Statue nicht ertragen. Sie hatte nämlich die unschuldige Magd auch noch aus dem Haus gejagt, weil sie sich so ärgerte, dass sich ihr Verdacht nicht bestätigt hatte. Welche Version der Sage auch immer man liest: Die Muttergottesstatue landet zum Schluss im Stephansdom. Dort wurde sie von vielen Bediensteten besucht, die sie um Hilfe baten oder ihr ihr Leid klagten. So kam die Statue zu ihrem Namen.
Die sogenannte Dienstbotenmadonna stammt aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und wurde aus Kalksandstein gefertigt. Sie ist das bedeutendste Werk der mittelalterlichen Wiener Plastik aus dieser Zeit und war früher bunt. Wahrscheinlich befand sich die kostbare und recht große Statue nie in einem Privathaushalt, sondern immer im Dom. Es ist aber nicht ganz klar, wo sie ursprünglich stand.

Nach dem Verlassen des Doms spaziert ihr um ihn herum, an seine Rückseite. Dort befindet sich an der Fassade des Doms die sogenannte Armeseelennische. Gegenüber findet ihr übrigens das Teehaus Haas & Haas, wo ihr Punsch zum Mitnehmen bekommt.
Zahnwehherrgott | Stephansplatz, 1010
Die steinerne Darstellung des gefolterten und gepeinigten Jesus stammt aus dem 15. Jahrhundert. Sie bekam den Beinamen Zahnwehherrgott nach einer Erzählung, die ab dem 19. Jahrhundert kursierte.
Der Sage nach hatten fromme Frauen der Christusstatue einen Blumenkranz aufgesetzt. Weil ein starker Wind ging, hatten sie den Kranz mit einem Band unter dem Kinn festgebunden. Als eines Abends drei betrunkene Wirtshausbesucher vorbeikamen, spottete der eine, der Herrgott habe wohl Zahnweh. Der andere fügte hinzu, dass das ja kein Wunder sei, nachdem der Herrgott ständig im Windzug stünde. Der dritte ergänzte, dass man ihm wohl einen Zahn ziehen müsse. Lachend gingen sie nach Hause. Aber noch in derselben Nacht bekamen alle drei schreckliche Zahnschmerzen, für die der Arzt keine Ursache finden konnte. Als die drei erfuhren, dass auch die jeweils anderen von mysteriösen Zahnschmerzen heimgesucht wurden, erkannten sie, was geschehen war: Die Schmerzen waren wohl ihre Strafe dafür, dass sie sich über die Statue lustig gemacht hatten. Sie warfen sich vor der Statue auf die Knie und baten voll ehrlicher Reue um Vergebung. Die Vorübergehenden wunderten sich nicht schlecht, dass drei stadtbekannte Trunkenbolde auf einmal andächtig vor Christus knieten. Nach der Andacht verschwanden die Zahnschmerzen der drei augenblicklich.

Geht nun nach rechts ein Stück weiter um den Dom herum. Von dort aus seht ihr den Nordturm des Stephansdoms, der nie vollendet wurde.
Nordturm | Stephansplatz, 1010
Der Nordturm des Stephansdoms wurde nie fertig gebaut. Er ist nur 68,3 Meter hoch geworden. Zum Vergleich: Der Südturm ist 136,4 Meter hoch. Eine Wiener Sage versucht zu erklären, wieso der Nordturm nie fertiggestellt wurde.
Als der Stephansdom fast vollendet war, schrieb die Stadt Wien einen Wettbewerb über den Bau des Nordturms aus. Wer die Arbeit am schnellsten und günstigsten erledigen konnte, sollte den Zuschlag bekommen. Der Architekt und Werkmeister Hans Puchsbaum soll sich beworben haben. Er hoffte, durch den Ruhm und die Ehre des Vorhabens die wohlhabenden Eltern seiner Geliebten Maria für sich begeistern zu können. Er bekam den Zuschlag und die Arbeiten begannen. Aber sie gingen zu langsam voran. Meister Puchsbaum sorgte sich um den Erfolg seines Bauprojekts. Eines Tages sprach ein Fremder den Werkmeister an und stellte sich als Teufel vor. Meister Puchsbaum wich erschrocken zurück, aber der der Teufel machte ihm ein unwiderstehliches Angebot: Er würde ihm helfen, den Turm in noch kürzerer Zeit fertigzustellen, als Puchsbaum es versprochen hatte. Aber dafür durfte der Werkmeister ein Jahr lang weder den Namen der Heiligen Jungfrau Maria noch irgendeiner anderen heiligen Person aussprechen. Das sollte gelingen, dachte sich Hans Puchsbaum, und ging den Pakt mit dem Teufel ein. Eine Zeitlang ging alles gut. Aber eines Tages lief Puchsbaums gebliebte Maria über den Stephansplatz. Er konnte es sich nicht verkneifen, vom Gerüst aus nach ihr zu rufen. Plötzlich schwankte das Gerüst, auf dem er stand, Mauerteile begannen einzustürzen. Der Werkmeister stürzte in den Tod und der Bau des Turms wurde eingestellt.
Der Vorsteher der Bauhütte des Wiener Stephansdoms zwischen 1444 und 1454 war tatsächlich Architekt und Steinmetz Hans Puchsbaum. Unter ihm wurden die Fundamente des Nordturms gelegt, aber der Bau begann erst nach seinem Tod. Tatsächlich gibt es mehrere Gründe dafür, dass der Nordturm nie vollendet wurde. Einerseits dürfen wohl wirtschaftliche Schwierigkeiten einen Anteil daran gehabt haben, andererseits die rasche nachhaltige Ausbreitung des Protestantismus in Wien ab 1520 und schließlich die Türkenbelagerung 1529. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts schließt ein Renaissance-Turmdach den Nordturm ab.

Wendet dem Nordturm den Rücken zu und macht euch auf den Weg zum vorletzten Stopp. Der führt euch vorbei am israelischen Lokal Miznon, durch die Strobelgasse und vorbei am Café Diglas, geradeaus weiter durch die Essiggasse, vorbei an der französischen Bäckerei Parémi und dem traditionellen Kaffee Alt Wien, wo es derzeit übrigens auch Punsch zum Mitnehmen gibt. Durch die Windhaaggasse gelangt ihr zur Schönlaterngasse
Basiliskenhaus | Schönlaterngasse 7, 1010
Die Schönlaterngasse entführt einen durch ihre Ruhe und die historischen Häuser in vergangene Zeiten. Der nächste Sagenort ist das Haus Nummer 7.
Im Haus, das früher an dieser Stelle stand, soll im Jahr 1212 aus dem Brunnen des Bäckers Martin Garhiebl ein schrecklicher Geruch gekommen sein. Beim Blick in den Brunnen sah man es in der Tiefe ungewöhnlich glitzern. Der Bäckergeselle Johann ließ sich von seinen Kollegen in den Schacht abseilen. Er wollte nachsehen, ob das Glitzern von einem versteckten Schatz stammte. Er war noch nicht einmal unten angekommen, da schrie er auf und ließ die Fackel fallen, die er in der Hand trug. Die anderen Gesellen zogen Johann wieder hoch. Er war bewusstlos geworden.
Als der Bäckergeselle wieder zu sich kam, erzählte er, was er unten gesehen hatte: ein hässliches Tier, das wie ein großer Hahn aussah, aber einen langen schuppigen Schwanz hatte, außerdem große Füße mit Krallen, glühende Augen und eine feurige Krone auf dem Kopf. Sein Atem soll fürchterlich gestunken haben. Mittlerweile hatten sich Schaulustige um den Brunnen versammelt. Ein weiser Mann trat aus der Menge heraus und stellte fest, dass der Bäckergeselle einen Basilisken gesehen haben musste: ein Tier, das aus einem Ei geschlüpft war, welches von einem Hahn gelegt und von einer Kröte ausgebrütet worden war. Der Anblick des Basilisken war tödlich. Man konnte daher versuchen, den Basilisken mit seinem eigenen Spiegelbild zu töten. Der Mann riet aber davon ab, es zu versuchen, denn es könnte einen das Leben kosten. Die einzig andere Möglichkeit wäre, den Brunnen zuzuschütten und den Basilisken auf diese Weise zu ersticken. Also warfen alle Erde und Steine in den Brunnen, bis er voll war. Johann war inzwischen wieder bewusstlos geworden und starb noch am selben Abend.
Zum Andenken an die Sage prangt ein Wandmalerei an der Fassade des Hauses Nummer 7 und in einer Nische darüber sitzt ein steinerner Basilisk als Hauszeichen. Heute vermutet man, dass sich damals im Brunnen giftige Erdgase gebildet haben.

Spaziert nun durch die Schönlaterngasse weiter Richtung Postgasse, wendet euch nach rechts, geht vorbei an der Dominikanerkirche und weiter zum Stubentor. Dort sind Reste der alten Wiener Stadtbefestigung zu sehen. Überquert den Ring und spaziert durch den Stadtpark zum goldenen Johann-Strauß-Denkmal.
Donauweibchenbrunnen | Stadtpark, 1010
Auf einem von Bäumen eingefassten gepflasterten Platz im Stadtpark steht der Donauweibchenbrunnen. Er wurde vom österreichischen Bildhauer Hanns Gasser geschaffen. Ursprünglich war die Statue aus Marmor geschlagen worden. Weil sie während des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt worden war, wurde sie nach Kriegsende durch eine Steinkopie ersetzt. Das Original wurde dem Wien Museum übergeben. Das marmorne Donauweibchen könnt ihr derzeit in der Online-Sammlung des Wien Museums sehen.

Wenn ihr noch nicht genug habt, könnt ihr einen Spaziergang durch die versteckten Innenhöfe und Geheimgänge Wiens machen. Oder ihr macht euch gleich auf zum zweiten Teil des Sagenspaziergangs durch die Innenstadt.