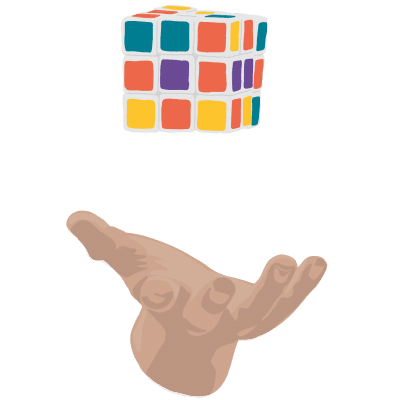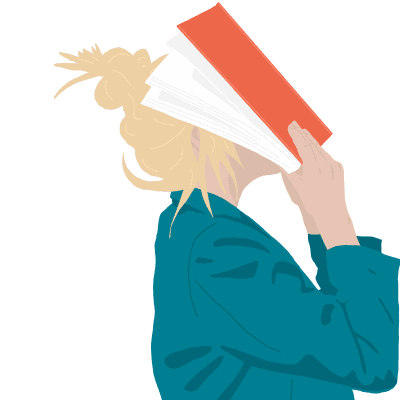Theater Delphin: Inklusives Theater exklusive Mitleid
Die Brücke zu schlagen zwischen Gleichbehandlung und dem Gerechtwerden besonderer Bedürfnisse ist schwer. Ein respektvoller, differenzierter Umgang miteinander hingegen nicht. Das beweist das Theater Delphin in seinen inklusiven Inszenierungen mit Menschen mit und ohne Behinderung. Hier geht es nicht darum, alle über einen Kamm zu scheren, sondern vor allem darum, das Leben in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen zu feiern.


Ivana Veznikova und ich sitzen im Raum neben dem Bühnenraum. Um uns herum liegen Kostüme und Requisiten. Nebenan probt Regisseur Tobias Schilling mit zwei Schauspielern Satz für Satz eine Zweierszene. Der einzige offensichtliche Unterschied zwischen Veznikova und ihren Kolleg*innen im Nebenraum: Sie sitzt im Rollstuhl. Darum soll es hier aber nicht gehen. Das hier ist keine Geschichte darüber, wie bewundernswert es ist, dass sie im Rollstuhl sitzt und trotzdem schauspielt. Es geht nicht darum, Mitleid zu heischen und Beifall zu klatschen für Dinge, die für Menschen wie sie ganz natürlich sind, nur weil sie scheinbar beeinträchtigt sind. Denn im Theater Delphin sind sie das nicht: beeinträchtigt. Hier gilt ihre draußen so oft als Schwäche wahrgenommene Behinderung als Stärke, als authentisch, und letztlich auch als künstlerisches Mittel. In dieser Geschichte geht es also um Menschen mit und ohne Behinderung, die miteinander professionelles Theater machen und ihre Einzigartigkeit feiern. Inklusionstheater heißt das in der Fachsprache, aber am besten wäre es wohl, würde man es einfach nur Theater nennen.
Schauspielerin aus Zufall
Ivana Veznikova ist 37 und arbeitet als Psychologin bei einer Stelle, die Jugendlichen mit Behinderung den Übergang von der Schule zum Berufsleben erleichtern soll. Sie selbst sitzt von Geburt an im Rollstuhl. „Ich bin zu früh auf die Welt gekommen und habe nicht genug Sauerstoff bekommen. Das hatte eine Hirnblutung und die wiederum eine Bewegungsstörung zur Folge“, erklärt sie. Das Bedürfnis, auf einer Bühne zu performen, hatte Veznikova nicht wie andere schon von Klein auf.
Aufs Theater Delphin ist sie eigentlich durch Zufall gestoßen, durch eine Recherche für ihren Job: „Ich habe hier zum ersten Mal etwas gefunden, was ich schon sehr lange gesucht habe: ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, das nicht gekünstelt ist oder einen mitleidigen Touch hat. Wo nicht der Eindruck entsteht, dass die Nicht-Behinderten die ganze Arbeit leisten, während die Behinderten mitgetragen werden, weil es eh schon toll ist, dass sie überhaupt irgendwas machen.“ Die 37-Jährige strahlt übers ganze Gesicht: „Jeder ist hier gleichermaßen gefordert, sein Maximum einzubringen.“ Ivana ist mittlerweile seit vier Jahren Ensemble-Mitglied.
Theater für den eigenen Sohn
Das Theater Delphin gibt es aber deutlich länger. Vor 18 Jahren hat Gabriele Weber den Verein Delphin gegründet, ursprünglich für ihren geistig und körperlich schwerbehinderten Sohn Nico. Obwohl er weder sprechen noch seine Muskeln anspannen konnte und hin und wieder sogar epileptische Anfälle hatte, merkte Weber, dass er sich durch Licht, Bewegung und Musik beruhigen ließ. „Ich habe oft mit ihm auf dem Arm getanzt“, erzählt sie. Im Unterschied zu Ivana Veznikova war Weber immer schon bühnenbegeistert. Und so entwickelte sich irgendwann der Plan, Kinder mit Behinderung auf die Bühne zu bringen; zunächst eigentlich nur, um genug Geld für eine Delphintherapie in Amerika aufzutreiben. „Also habe ich ein Stück über den Schwarz-Weiß-gestreiften Delphin Nico geschrieben, der einen Freund sucht. Darin ging es offensichtlich um meinen Sohn“, erzählt Weber.
„Die erste Aufführung war magisch: Die Lichtkünstlerin Victoria Coeln hat uns ein Bühnenbild aus Licht installiert, das alles geflutet hat.“ Weber trug ihren Sohn Nico auf den Armen und tanzte mit ihm durch den Lichtraum. Plötzlich schaffte es Nico, zu reagieren und seinen Kopf nach oben zu wenden. Das war außerhalb dieser Mischung aus Musik, Licht und Tanz sonst nicht möglich. Auch bei anderen Stücken war es nicht dasselbe. Aber wenn „Nico“ gespielt wurde, konnte plötzlich auch Nico spielen.

Im Alter von 12 Jahren verstarb er. Doch das Theater Delphin spielt bis heute. Nur seinen „Nico“ nicht mehr. „Das ist sein Stück“, sagt Weber. Mittlerweile sind 18 Jahre vergangen seit ihrem ersten Schritt auf die Bühne. Aus Kindern sind mittlerweile Erwachsene geworden, aus einem anfänglich karitativen Ansatz ein vornehmlich professionell-künstlerischer. „Wir kämpfen immer wieder gegen die Auffassung, dass alles, was mit Menschen mit Behinderung zu tun hat, Therapie wäre“, sagt Georg Wagner, Gabriele Webers Lebensgefährte. Er stieß vor 18 Jahren eher zufällig zum Theater Delphin dazu – und blieb. „Natürlich ist Therapie für viele Menschen sehr wichtig. Aber es ist genauso wichtig, die Leute auf künstlerischer Ebene zu fördern, wenn sie das wollen.“

Der Sonderpädagoge und die Röntgenassistentin
Warum aber eine sonderpädagogische Ausbildung hier dennoch durchaus wichtig ist, obwohl doch der therapeutische Ansatz nicht im Vordergrund stehen soll, leuchtet ein: „Man sollte wissen, wie man mit bestimmten geistigen Behinderungen am besten umgeht“, erklärt Wagner. „Es macht professionelles Inklusionstheater einfach aus, dass jemand dabei ist, der sonderpädagogisch geschult ist und weiß, wie er an manche Menschen vielleicht besser herankommt. Das unterscheidet uns ja auch von einer herkömmlichen freien Theatergruppe.“ Es geht nicht darum, zu therapieren oder klein zu machen. Es geht lediglich darum, den besonderen Bedürfnissen mancher Schauspieler der Gruppe gerecht zu werden und sie weder zu über- noch zu unterfordern. Wagner hat ursprünglich Rhythmik mit Schwerpunkt auf Sonder- und Heilpädagogik studiert. Danach schlug er sich mit Straßentheater und als freier Schauspieler durch und landete sogar kurzzeitig am Wiener Burgtheater. Im Theater Delphin laufen also zwei Wege endlich zusammen. Zurzeit arbeitet er tagsüber als Nachmittagsbetreuer in einer inklusiven Volksschule.
Anders als ihr Partner kommt Gabriele Weber weder aus der pädagogischen noch aus der schauspielerischen Ecke. Sie ist bis heute brotberuflich Röntgenassistentin, weil das Theater aufgrund zu geringer Förderungen und viel Aufwand nicht genug abwirft, um davon zu leben. Das Theaterhandwerk hat sie sich auf dem Weg zusammengesammelt durch Schauspiel- und Dramaturgieausbildungen, theaterpädagogische Schulungen und Ähnliches. Überdies hat Weber als Mutter eines schwerbehinderten Kindes aus Elternperspektive am eigenen Leib erfahren, was diese Art von Behinderung mit sich bringt. „Für manche unserer Schauspieler, die nicht fähig sind zu sprechen, brauche ich keinen Sprachcomputer. Ich habe durch Nico eine andere Art der Kommunikation erlernt“, sagt sie. „Ich wusste immer genau, was er braucht und wann er sich wohlfühlt. Es gab eine spezielle intuitive Verständigung zwischen uns.“

Castings und Vorbereitungsstunden
Was Inklusionstheater ausmacht, ist die Zusammenarbeit von Schauspieler*innen mit und ohne Behinderung. Die Schauspieler ohne Behinderung werden zum Casting eingeladen. Die Spieler*innen mit Behinderung können sich in einem einführenden Schauspieltraining auf die Bühnenarbeit vorbereiten. „Wir haben mittlerweile ein so gutes Level in unseren Gruppen, dass es nicht gut wäre, jemanden ohne Spielerfahrung direkt in eine Gruppe zu stecken“, erklärt Georg Wagner. „Die Leute müssen zuerst einige Eckpfeiler und Grundregeln des Schauspielens beherrschen.“ Ein Casting für Menschen mit Behinderung wäre genau betrachtet irgendwie unfair. Immerhin gibt es in Österreich keine Schauspielausbildung, die auch eine inklusive Schiene fährt. Also kommen die meisten mit wenig bis keiner Bühnenerfahrung zum Theater Delphin. Was man in einem Casting also maximal ablesen könnte, wäre ein gewisses darstellerisches Talent. Und auch das entwickelt und verändert sich bei vielen Spielenden mit der Zeit.
Was gelungenes inklusives Theater ausmacht
Auch die Erarbeitung eines Stückes spielt sich bei derart unterschiedlichen Spielenden natürlich etwas anders ab als etwa am Wiener Burgtheater. Sie kann schon mal bis zu einem Jahr dauern, ist dafür aber auch maßgeschneidert auf die einzelnen Darsteller. Der Prozess beginnt mit einer gemeinsamen Ideensammlung, einem Einziehen des roten Fadens und viel Improvisation. Manche Gruppen machen auch Stückbearbeitungen, andere arbeiten mehr mit Tanz und Musik oder schreiben ihre Stücke lieber selber. Dabei gilt die Behinderung keineswegs als Defizit, sondern im Gegenteil als authentisches körperliches oder charakterliches Merkmal.
Man muss die Rollen eben stärker auf die Spielenden zuschreiben, je nachdem, wo Stärken und Schwächen liegen: „Wir haben zum Beispiel Spieler mit Downsyndrom, die nicht so gut sprechen, sich dafür aber umso großartiger bewegen können“, meint Gabriele Weber. „Oder ein Spieler hat drei, vier Sätze, die er gut sprechen kann, die er dann aber auch auf eine ganz besondere Art spricht, wie es sonst keiner könnte.“ Kurz gesagt: Es geht darum, authentisch zu bleiben. „Man kann nicht jeden alles spielen lassen. Das geht bei Menschen ohne Behinderung auch nicht, aber da ist eben die Bandbreite eine größere“, setzt Wagner nach.

Große Vielfalt und ihre Schwierigkeiten
Dass das bei all der Vielfalt nicht unbedingt immer leicht ist, liegt auf der Hand. Für Georg Wagner ist es vor allem der technische Aspekt, der fordert: Die Theaterräumlichkeiten, in denen man spielt, müssen barrierefrei sein. Dann kommt es auch darauf an, wie sich die Assistent*innen, die einige Rollstuhlfahrer*innen im täglichen Leben unterstützen, eingebaut werden können. Können sie hinter der Bühne mithelfen, oder vielleicht sogar auf der Bühne? Oder stehen sie gelangweilt auf der Bühne und bringen damit die Aufführung ins Wanken?
Gabriele Weber sieht die Schwierigkeit eher in der Zusammenarbeit selbst: „Es ist schon eine Herausforderung, eine so bunte Gruppe auf einen Nenner zu bringen.“ Besonders die unterschiedlichen Aufmerksamkeitsspannen bringen manchmal Unruhe hinein. Denn wie es am Theater nun einmal ist, können nicht immer alle gleichzeitig spielen. Der*die Regisseur*in greift Einzelszenen oder sogar Monologe heraus und arbeitet gezielt mit einzelnen Schauspieler*innen. Für die anderen ist dann erst mal warten angesagt. „Vom Zuschauen lernt man natürlich am meisten, aber da fehlt oft die Aufmerksamkeit, vor allem von jenen mit stärkerer Beeinträchtigung“, sagt Weber. „Da helfen Anfangsspiele und Improvisation sehr gut, wenn das Stück am Entstehen ist. Aber wenn es ums Konkretere geht, ums Wiederholbare einer Inszenierung – das ist die Knochenarbeit.“

Das Publikum zwischen Lob und Diskriminierung
Doch die macht sich offensichtlich bezahlt: Das Feedback nach den Aufführungen ist laut Weber und Wagner durchwegs positiv, wenn auch nicht immer hundertprozentig ehrlich. „Es ist irrsinnig schwer, von den meisten Leuten ehrliche Kritik zu bekommen“, meint Weber. Wichtig war ihr aber immer schon, die Stärke in den Vordergrund zu stellen, die mit einer Behinderung einhergeht, und eben nicht, an das Mitleid der Zuschauer*innen zu appellieren. Georg Wagner fände es am besten, wenn sie anfangs gar nicht wissen würden, dass es sich um Inklusionstheater handelt, weil sie sonst oft schon mit einer gewissen Voreingenommenheit den Saal betreten. „Wissen sie aber nicht, was sie erwartet, kommt es in den meisten Fällen zu einem positiven Erstaunen, dass das, was wir machen, eine so große Qualität hat“, sagt er.
Neben positivem oder zumindest verkrampft-lächelndem Feedback hatten Weber und ihre Truppe besonders in den Anfangsjahren mit weniger wohlwollenden bis hasserfüllten Kommentaren zu kämpfen. Eines davon ist besonders in Erinnerung geblieben: „In den Anfangsjahren haben wir öfter im Purkersdorfer Stadtsaal gespielt“, rekapituliert Weber. „Als wir mit einem Mädchen mit Downsyndrom unterwegs waren, kam uns ein älteres Ehepaar entgegen und der Mann sagte: ‚Früher haben sie sie vergast. Heute züchten sie sie’.“ Gabriele Weber hält inne. Nach all den Jahren ist sie immer noch sichtlich schockiert. Wir sitzen einander betreten gegenüber. Unfassbar. „Es ist ein gewisses Gedankengut, das sich leider immer noch nicht erledigt hat“, zieht sie schließlich die Bilanz.

Trotzdem weitermachen, oder gerade deshalb
Doch die Konsequenz daraus ist nicht, dass man sich ins dunkle Kämmerchen zurückzieht und einschüchtern lässt, im Gegenteil: Dem Theater Delphin geht es letztlich auch um das Sichtbarmachen von Menschen mit Behinderung, das Präsentsein mit ihren Inszenierungen, manchmal auch mitten im urbanen Raum. Vor einiger Zeit wurde etwa ein Stationentheater zum kontroversen Thema „Behinderung und Sex“ veranstaltet, Menschen auf der Straße dazu befragt oder etwa ein Speed-Dating-Setting im Theater eingerichtet. Auch die im Oktober gespielte Inszenierung Zwei Stunden der Ensemble-Gruppe, die fortgeschrittenste der insgesamt vier Gruppen, wurde unter der Regie von Tobias Schilling auf die Straßen des zweiten Bezirks aufgeführt. Sie befasste sich mit der Vertreibung der Sudentendeutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg – eines von vielen Themen, das sich in Österreich immer noch hartnäckig hinter festgezurrten Scheuklappen versteckt.
Ivana Veznikova ist in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren. Als sie sechs Jahre alt war, flohen ihre Eltern mit ihr nach Österreich, in einer Zeit kurz vor der Samtenen Revolution 1989, in der es in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik politisch schon gewaltig brodelte. Einige Szenen wird sie diesmal daher auch in ihrer Muttersprache, auf Tschechisch spielen. „Was ich an diesem Stück so wichtig finde für die Aufarbeitung der Geschehnisse in beiden Ländern, ist die Einsicht, dass es in ganz drastischen Situationen kein Richtig und kein Falsch mehr gibt, weil alles aus den Fugen geraten ist. Gewisse Konflikte und Thematiken wiederholen sich immer wieder. Gewisse Schwierigkeiten sind zeitlos.“
Ihr wollt noch mehr Reportagen? Wie wär’s dann zum Beispiel mit unserem Ausflug ins AKW Zwentendorf? Wenn ihr kein Update mehr verpassen wollt, registriert ihr euch am besten auf unserer Website und folgt der Liste Reportagen.