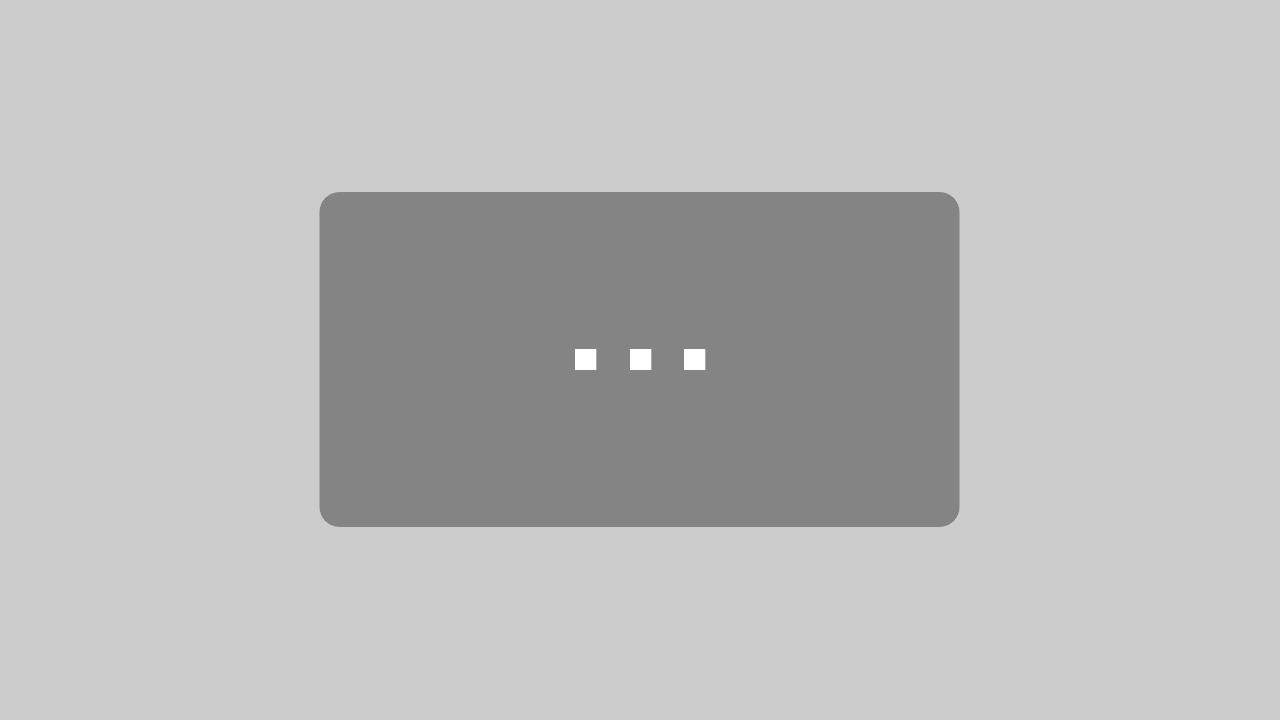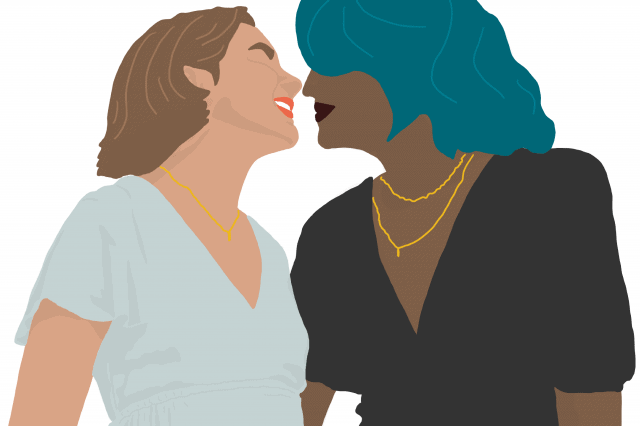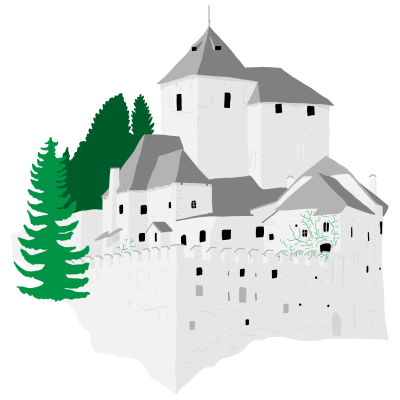Unser Senf: Warum es so schwer ist, meiner Oma zu helfen


Als der Krieg vorbei war, war sie acht. Bis heute erzählt sie, wie ihre Mutter Motoröl zum Abbrutzeln der Bratkartoffeln verwendet hat. Bei vielen Geschichten sind wir uns nicht mehr sicher, ob sie wirklich so passiert sind oder ob sie sie durcheinanderbringt. Aber das spielt keine Rolle. Entbehrungsreich war ihre Kindheit jedenfalls. Entbehrungsreich und trotzdem irgendwie glücklich. Das merkt man, wenn sie von den kleinen Momenten damals erzählt, wie ihr Vater sich etwa einfach zum Klavier gesetzt und mit den Kindern musiziert hat, weil er früher mal als Gasthauspianist gejobbt hat. Oder wenn sie stolz von ihrer eigenen Großmutter erzählt, die so wüst schimpfen konnte, dass sie sogar „einen Kutscher beleidigen konnte“. Ihre Großmutter, die Sandwerk-Oma, führte die Hütteldorfer Sandwerke und hieß den Hitler das Arschlecken. Erst als ein Nazi-Scherge ihr die Pistole an den Kopf hielt, um sie einzuschüchtern, verstummte sie. Ein Schlaganfall, vor lauter Schreck.
Vom Kuchl-Kabinett…
Meine Oma stammt einer Linie von starken Frauen ab. Sie selbst brach fast mit ihrer Familie, der Liebe wegen: Ein „Gscheada“ war er, aus einem nur wenige Seelen kleinen Dorf im Weinviertel, der dem eigenwilligen Wiener Großbürger-Dünkel einfach nicht entsprach, der bis heute in ihrem Zweig der Familie mitschwingt und so ganz und gar nicht zur Motoröl-Geschichte passen will. Der Opa und die Oma hatten also erst einmal nicht viel, als sie in ihre erste „Ein-Zimmer-Kuchl-Kabinett“-Wohnung in Wien eingezogen sind. Das Kind, das sich recht bald danach ankündigte, badeten sie in der Abwasch, das Tröpferlbad war nie eine Option. Später kam die erste große Anschaffung: eine Dusche, direkt neben der Abwasch und damit mitten in Vorzimmer und Küche zugleich. Neben Kinderbetreuung und Arbeit in einer Bank machte die Oma schließlich mit Anfang 30 ihre Matura nach, lernte Autofahren und schwimmen. Sie wurde Lehrerin für Stenografie und schließlich sogar Direktorin. Die ersten Jahre hieß es, eisern sparen für die Zukunft. Reinbeißen, damit es sich später auszahlt.
…zum Eigenheim
Und das tat es. Sie bauten sich ein Haus, ein großes sogar mit weitläufigem Garten und kleinem Wald. Aus Kindern wurden Enkelkinder, aus dem Schwiegersohn eine familiäre Bürde. Die Scheidung kam und die Enkerln kommen jetzt umso öfter. Ihre Tochter muss weiter arbeiten, also geht sie vorzeitig in Pension. Sie jongliert Hausarbeiten, Schularbeiten, Mittagessen, ohne murren, immer liebevoll. Kein Weg ist zu weit, keine Anstrengung zu hoch. Zeit für sich hatten die Großeltern nicht viel, doch darum schien es ihnen nie zu gehen. Auch nicht, als die Enkerln schon längst groß sind. Ein paar viel zu große Weihnachtsschecks und nächtliche Abholaktionen später wird ihr Mann schwer krank. Lymphdrüsenkrebs. Am Anfang hieß es, ihm bleiben nur ein paar Monate. Daraus wurden dann doch noch gute drei Jahre. „Weil ich ihn zu mir nachhause geholt habe“, sagt die Oma. Sie ist fest davon überzeugt, dass ihre Kochkünste und ihre Pflege den Opa so lange über Wasser hielten, bis es wirklich nicht mehr ging. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Am meisten hat er sich immer davor gefürchtet, wieder ins Windelstadium zurückzuschrumpfen. Seine erste und letzte Windel hat sie ihm selbst angelegt.
Schwäche ist keine Option
Dann schlief er ein und wachte nicht mehr auf. Aber die Oma, die blieb stark. Für die Tochter, für die Enkerln und letztendlich auch für sich. Obwohl etwas für sich selbst zu tun ihr nicht leicht fällt. Bis heute nicht. Der Opa ist mittlerweile zwei Jahre tot, die Oma lebt noch immer in dem großen Haus, das sich die beiden selbst gebaut haben, sitzt noch immer in ihrem grünen Samtsessel und liest wahrscheinlich den ganzen Tag Zeitung und pflegt den Garten. Doch genau weiß eigentlich keine von uns, was die Oma den lieben langen Tag so macht. Sie will nicht, dass wir uns um sie kümmern, und schon gar nicht will sie, dass wir glauben, sie sei einsam. „Ich hab den Garten, ich hab den Haushalt, und am Abend hab ich den Fernseher und ein Glaserl Wein“, grinst sie uns trotzig entgegen, wenn wir sie wieder einmal fragen, ob ihr nicht furchtbar fad ist und wir sie nicht öfter besuchen kommen sollen.
Dass wir es aber momentan nicht einmal könnten, wenn wir wollten, macht ihr umso mehr zu schaffen. Drei Anläufe habe ich gebraucht, um ihr übers Telefon zu erklären, warum das zurzeit nicht geht und dass wir sie dadurch gefährden würden. Zuerst meinte sie, das könne doch alles nicht so schlimm sein, „des Corona“. Dann erklärte sie trotzig, dass sie ja sowieso irgendwann einmal sterben müsse. Beim dritten Gespräch hörte sie endlich zu. Ein bisschen jedenfalls.
Zwischen Supermarkt und Friedhof
Denn das, was früher notwendige Stärke war, ist im Alter zu Märtyrertum und Sturheit geworden. Sie kann eben einfach nicht anders. Sie muss sich kümmern und will um Herrgottshimmelswillen nicht bekümmert werden. Das wollte sie nicht nach ihrer Diagnose, das wollte sie nicht, als es sie wieder einmal aufgeprackt hat, und das will sie erst recht nicht jetzt, wo alle narrisch werden wegen etwas, das sie selbst nicht ganz begreift. Als ich sie angerufen habe, um ihr anzubieten, ihre Einkäufe zu übernehmen, saß sie gerade fröhlich jauchzend mit einem Bekannten im Kaffeehaus. „Aber geh, wir knutschen uns ja nicht ab“, schmähtandelte sie, mitten in meinen Vortrag darüber, dass sie doch zur Corona-Risikogruppe gehöre und am besten zuhause bleiben so… Bringt nichts. Einkaufen muss sie gehen und zum Grab vom Opa auch. Das ist eben ihre Routine, die sie braucht, damit sich überhaupt irgendetwas tut – wobei sie das natürlich nie zugeben würde.
Dass sie wenigstens nicht mehr in den Supermarkt geht, das haben wir ihr inzwischen abgerungen. Natürlich nicht um ihrer selbst willen. Nein, das Argument, das schließlich gezogen hat, war ihr übervoller Tiefkühlschrank im Keller und die zahlreichen anderen Vorräte, die sie seit Jahren bunkert und die sonst wahrscheinlich eh schlecht würden. Also braucht sie die jetzt erst mal auf. Da wär ja auch schad‘ drum! Verschwendung zieht also, Selbstschutz nicht. Den Opa besucht sie trotzdem jeden Tag um sieben Uhr Früh am Friedhof. Das kann ihr keiner nehmen und das traut sich auch keiner. Aber wenigstens fährt sie dorthin nicht mehr mit dem Bus – „die Leut‘ schnäuzen sich und drücken danach den Knopf, da graust ma eh“. Also macht sie eben einen ausgedehnten Spaziergang, die unaufhaltsame, 83-jährige Dampfmaschine. Ob ich nicht vielleicht diesen Sonntag schon zum Mittagessen kommen kann? Nein, die Rindsrouladen müssen leider warten. Aber bald, Oma, bald kannst du mich wieder mästen. Und dann hoffentlich noch jahrelang.
Wenn ihr anderen Menschen aus den Risikogruppen in eurem Umfeld helfen wollt, macht doch mit bei der Nachbarschaftschallenge. Außerdem gibt es noch ein paar andere Initiativen, die ihr momentan unterstützen könnt.
(c) Beitragsbild | Pixabay