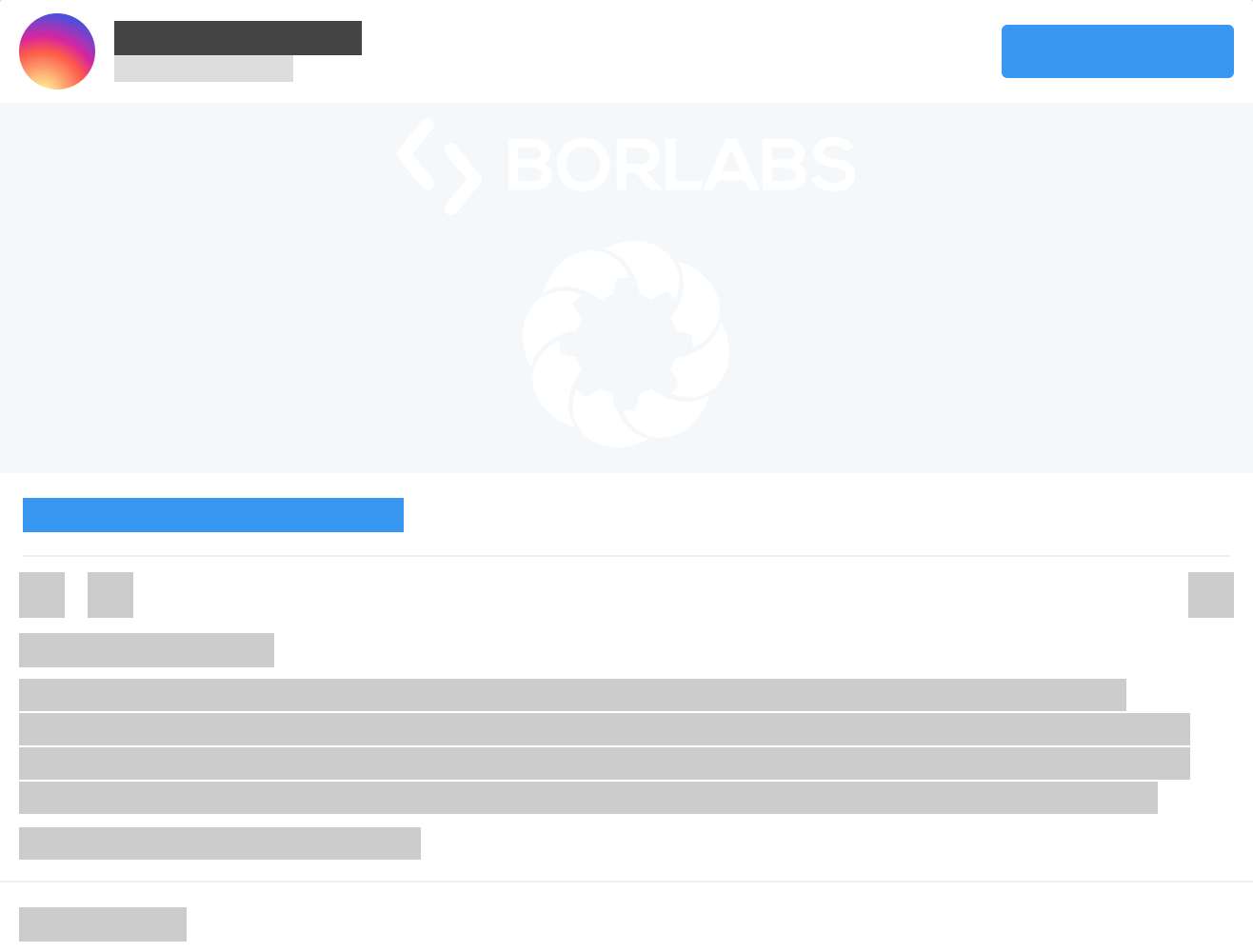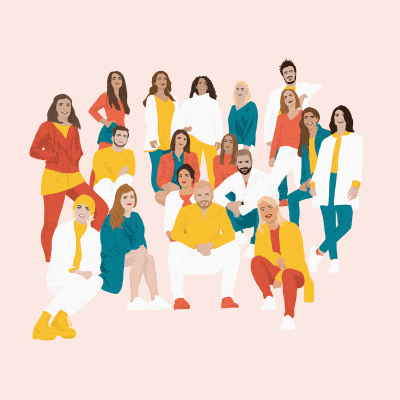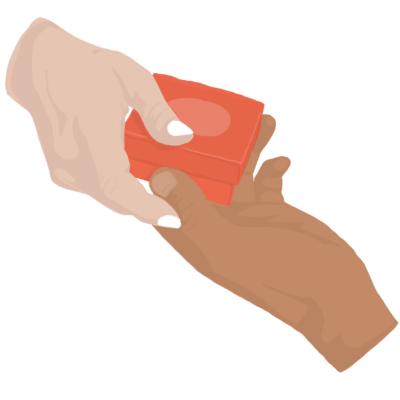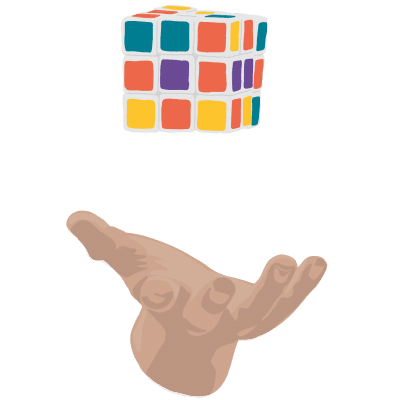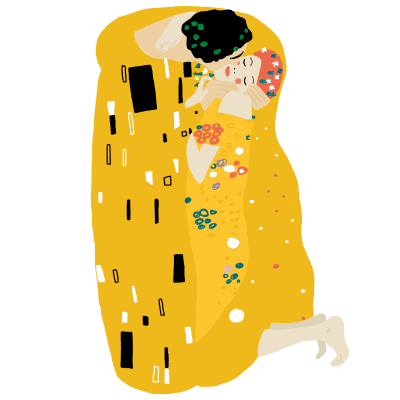Unser Senf: Warum wir alle mehr Rosa tragen sollten
Weil ein bisschen Würze im Leben nie schaden kann, geben wir euch mit dieser Kolumne regelmäßig unseren Senf dazu: Wir erzählen euch, was uns beschäftigt, was uns nervt und was uns zum hysterischen Lachen bringt. Eure Käsekrainer könnt ihr zwar nicht darin eintunken, aber dafür ist unser Senf auch gratis. Dieses Mal hält unsere Redakteurin ein Plädoyer für die Farbe Rosa und gegen Misogynie.


Es gibt da diesen Trend, das Geschlecht eines ungeborenen Babys zu verkünden, indem man eine Torte anschneidet, die dann innen entweder rosa oder blau ist. Rosa heißt, es wird ein Mädchen, blau, es wird ein Junge. Bevor wir auf die Welt kommen, sind wir also in den Köpfen vieler erst einmal ein rosa oder blauer Fleck auf der demographischen Landkarte. Das ist auf mehreren Ebenen problematisch: Zum einen, weil wir uns im 21. Jahrhundert endlich mit dem Gedanken abfinden sollten, dass Geschlechter nicht binär, sondern vielmehr fluide sind. Niemand von uns ist oder verhält sich zu 100 Prozent typisch weiblich oder typisch männlich, was auch immer das bedeuten mag. Zum anderen, weil auch Mädchen auf Blau stehen dürfen und Jungs auf Rosa.
Barbie Girls?
Es braucht also nicht mehr als zwei Farben und wir sind mittendrin in der Debatte um die Geschlechterklischees. Doch das war nicht immer so, oder schon, aber andersrum. Rosa Kleidung war bis in die Vierzigerjahre nämlich überwiegend Buben vorbehalten, Mädchen trugen Himmelblau. Zum Wandel dieser Klischees gibt es mehrere Theorien. Gefestigt wurde er jedenfalls in den 50ern, als die erste Barbie in pinkfarbener Verpackung auf den Markt kam und Rosa so zur Lieblingsfarbe vieler Mädchen wurde. Bis heute werden Produkte speziell für weibliches Publikum gebrandet, indem sie rosa eingefärbt werden. Pink Tax nennt sich das Prinzip, wenn diese Produkte dann auch noch teurer sind als jene für Männer.
Dass Mädchen genauso mit Matchbox-Autos spielen können und Buben mit Puppen, ist eine Diskussion, die längst im Gange ist. Aber oft geht sie in die falsche Richtung, oder zumindest nur in eine. Nämlich dahin, dass man gerne betont, dass „auch Mädchen Buben-Sachen machen können“. Das soll wohl empowernd sein, ist aber am Thema vorbei. Denn wenn wir bloß Mädchen und Frauen großmütig Dinge zugestehen, die gesellschaftlich überwiegend als typisch männlich gelesen werden, und das als große Errungenschaft für unsere Gleichstellung feiern, machen wir damit eigentlich genau das Gegenteil: Wir werten das als typisch weiblich Geltende ab.
Verinnerlichte Misogynie
Um sich innerhalb des patriachalen Systems zu behaupten, müssen Mädchen und Frauen oft doppelt so hart arbeiten oder sich überhaupt erst einmal beweisen. Das ist etwa im Sport so, das ist im Büro-Alltag oft nicht anders. Natürlich haben wir inzwischen einige Fortschritte gemacht, aber der Weg ist immer noch weit. Allein schon, dass „ein Mädchen sein“ nach wie vor als Abwertung verwendet wird, als Synonym für „schwach“, während „ein Mann sein“ eine verbale Ehrerbietung ist, zeigt, wie oft wir Weiblichkeit als etwas Nachteiliges behandeln. „Bitch“, „Tussi“, „Pussy“ oder „Fotze“ verwenden viele wie selbstverständlich als Schimpfwörter, während zum Beispiel „Macho“ nicht mal halb so abwertend daherkommt. Und der Penis muss im Deutschen auch nicht für verbale Schlagabtäusche herhalten, dafür prangt er selbstbewusst auf Häuserwänden und eingeschneiten Motorhauben.
Warum ist es gesellschaftlich vollkommen anerkannt, etwa stundenlang über Männerfußball zu diskutieren, aber die Nasen rümpfen sich, sobald man sich am Stammtisch über Mode oder Make-up unterhalten will? Weil Interessen, Themen und Stereotype, die als typisch männlich gelten, einen höheren Stellenwert genießen als angeblich typisch weibliche. Das erklärt auch, warum viele Mädchen früher oder später die „Ich hasse rosa“-Phase durchlaufen und sich bewusst von Dingen abwenden, die als typisch mädchenhaft gelten, um selbst eben nicht als mädchenhaft zu gelten. Man nennt das auch internalisierte Misogynie, und die betrifft uns alle.
Weiblichkeit ist bunt
Als Jugendliche habe ich zum Beispiel überwiegend Baggy Pants und Kappen getragen, war stolz, wenn mich jemand burschikos nannte, und habe behauptet, lieber mit den Burschen zu spielen, weil mir Mädchen „zu kompliziert“ wären. Heute schäme ich mich dafür, weil ich weiß, dass ich mich nicht aus mir selbst heraus so verhalten habe, sondern, um den Jungs zu gefallen, indem ich andere Mädchen bewusst abgewertet habe. Aber gleichzeitig weiß ich, dass das nicht allein meine Schuld ist, sondern dem System geschuldet, in dem wir aufwachsen. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass alle Mädchen und Frauen sich für Make-up und Glitzer interessieren sollen – um mal mit vollem Schwung in die Klischee-Pfütze zu steigen. Ich will damit nur sagen, dass Frau sein oder als weiblich gelesen werden weder das eine noch das andere sein muss.
Wir wollen uns von den Klischees, die man uns zuschreibt, lösen, und das sollten wir auch. Aber nicht, weil das eine gesellschaftlich schlechter oder besser gewertet wird als das andere, sondern um einfach nur wir selbst sein zu können – was auch immer das bedeutet. Und zwar, ohne andere Frauen und weiblich gelesene Personen, die diesen Klischees vielleicht entsprechen, dafür zu shamen. Du willst auf Instagram ein Foto von deinen frisch lackierten Nägeln posten? Tu es. Du willst an deinem Auto rumschrauben und dabei Death Metal hören? Tu es. Du willst dabei kurze Röcke und jede Menge Eyeliner tragen? Hell yeah, tu es. Es gibt keinen Grund, warum eine Astrophysikerin sich nicht gleichzeitig auch für Mode interessieren darf, warum jemand mit kurz geschorenen Haaren, Lederjacke und Tattoos nicht gleichzeitig auf Britney stehen sollte, warum eine Frau mit starkem Make-up, wasserstoffblonden Haaren und figurbetonendem Outfit nicht fundierte politische Abhandlungen schreiben könnte. Außer natürlich den offensichtlichen: ein System, das das typisch Männliche bevorzugt.
Nicht abwerten, sondern aufwerten
Natürlich sollten wir uns über kurz oder lang – und lieber über kurz als über lang – generell von solchen Stereotypen verabschieden. Wir brauchen sie nicht, sie helfen uns nicht und wir sollten eigentlich schon ein gutes Stück weiter sein. Weil das aber offenkundig nicht so ist, können wir einstweilen zumindest daran arbeiten, die Stereotype in unserem Wertesystem aneinander anzugleichen. Denn das hilft letztlich uns allen. Je neutraler und wertfreier wir mit Dingen wie Sanftmut, Emotionalität, Intimität oder auch einfach nur Banalitäten wie der Farbe Rosa umgehen, desto leichter können wir uns auch von Dingen wie toxischer Männlichkeit verabschieden, die uns ebenfalls nicht weiterbringen, sondern höchstens zurückwerfen. Also, egal ob weiblich oder männlich oder wo auch immer ihr euch in diesem Spektrum bewegt: Spielt Fußball, diskutiert über Make-up, seid tough oder seid zärtlich, und tragt das rosa Shirt, wenn es euch gefällt. Dann können wir all diese klischeebehafteten Dinge vielleicht endlich als das sehen, was sie sind: Hobbies, Charakterzüge und nicht mehr als eine Mischfarbe aus Weiß und Rot.
Ihr wollt euch in Zukunft mehr mit Feminismus befassen? Wir zeigen euch ein paar feministische Instagram-Accounts, denen ihr dafür unbedingt folgen solltet. Außerdem erklärt unsere Redakteurin, warum wir den Feminismus heute immer noch brauchen.