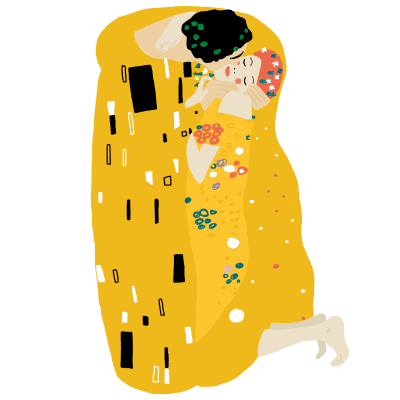Unser Senf: Wie sich unser Konzertverhalten verändert hat
Weil ein bisschen Würze im Leben nie schaden kann, geben wir euch mit dieser Kolumne regelmäßig unseren Senf dazu: Wir erzählen euch, was uns beschäftigt, was uns nervt und was uns zum hysterischen Lachen bringt. Eure Käsekrainer könnt ihr zwar nicht darin eintunken, aber dafür ist unser Senf auch gratis. Dieses Mal macht sich unsere Redakteurin Gedanken darüber, wie anders sie sich auf Konzerten verhält im Vergleich zu ihrem Teenie-Ich.


Wenn die Pubertät zuschlägt, dann mit voller Breitseite. In meinem Fall hieß das bemalte Converse-Kappen und Leopardenstrumpfhosen, auftoupierte Haare und viel zu dickes Pandabär-Augen-Make-Up, verkrampft nach oben schauende Selfies und betont lässig nach unten gedrückte Schachbrettgürtel. Auf dem Spektrum der maßgetischlerten Schubladen der Subkulturen habe ich also irgendwo zwischen Emo und Punk mitgeschubladelt. Alles, was von dieser, wie ich behaupte, „wilden Zeit“ übrig blieb, ist ein etwas größeres Loch in meinem linken Ohr, wo früher mein rebellischer Dehnungsohrring prangte. Das war die einzige körperliche Modifizierung, für die man keine Einverständniserklärung der Eltern brauchte. Guter Schachzug, dachte ich. Und was fürs Leben. Denn offensichtlich wächst ein acht Milimeter weit aufgedehntes Ohr doch nicht mehr ganz zu. Danke, dubioser Piercer aus dem Kaufhaus. Danke für nichts.
Ich könnte noch endlos viele Zeilen damit füllen, mein peinliches Teenie-Ich nachträglich bloßzustellen. Aber sich öffentlich über einen unsicheren Teenie in der Selbstfindungsphase lustig zu machen, wäre fast so, wie einem Baby den Schnuller aus den Mund zu reißen: zu einfach, maßlos unnötig und irgendwer wird weinen.
Einmal wieder 16 sein!
Außerdem verdeckt der unmotivierte Grant auf jemanden – auch wenn es sich um das eigene vergangene Ich handelt – meist nur, was viel tiefer sitzt: Neid. Denn ja, ich geb’s zu, manchmal wäre ich schon ganz gerne wieder 16, würde meinen Steuerausgleich gegen alle möglichen Festivalpässe und meinen gesunden Ernährungsplan gegen Happy Noodles vom Schwedenplatz eintauschen.
Doch eine Situation gibt es, in der ich ganz besonders gerne wieder Teenie wäre: auf Konzerten. Denn egal ob softer Pop bei Annenmay Kantereit oder harter Metal bei As I Lay Dying – bei vergangenen Konzerten wurde die Stimme in meinem Kopf immer lauter, die raunt: „Du bist alt. Was machst du überhaupt hier? Du solltest längst in deinem Lehnstuhl sitzen und bei der Hälfte von ‚Der Alte’ wegdösen.“ Okay, okay, ganz so eingerostet ist mein Party-Ich natürlich auch nicht – die Stimme in meinem Kopf ist ein pessimistischer Owezahrer. Aber dennoch: Wie meine Freund*innen und ich auf Konzerte gehen und wie wir uns dort verhalten, hat sich in den vergangenen zehn Jahren radikal verändert.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Von harten Säuen…
Allen voran geht’s um die Attitüde: Früher hat man das ganze Spektakel und den Personenkult um einzelne Musiker*innen einfach viel ernster genommen. Da gab’s kein Trödeln beim Fertigmachen, keinen unvorhergesehenen Zwischenstopp bei der Tankstelle für ein Wegbier. Nein, schon eine halbe Stunde vor Einlass standen wir uns aufgeregt die Beine in den Bauch, nur damit wir uns erst recht durch schwitzende, alksaftelnde Körper möglichst weit nach vorne reiben konnten, um den Musiker*innen so nah wie bei zehn Securitys nur irgendwie möglich zu sein. Auf Festivals hielten wir ab Mittag die Stellung, wenn abends unsere Herzensband angekündigt war, verzichteten auf zu viel Trinken, weil wir uns sonst den ekligen Dixi-Klos erbarmen mussten, und kreischten panisch – und etwas dehydriert –, wenn dann endlich der lang ersehnte Hauptact die Bühne betrat.
Man merkt schon – vieles davon hört sich alles andere als erstrebenswert an. Aber die flammende Leidenschaft, unter widrigen und teils widerlichen Bedingungen durchzuhalten, sie auszuhalten, nur um eine Band meinen Song spielen zu hören, für die sich mein Gesicht nicht von dem restlichen Gesichtsgulasch zu ihren Füßen abhebt, bewundere ich nachträglich ehrlich. Respekt, Mini-Me, du harte Sau.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
… zu faulen Mimosen
Denn heute hat sich die vorfreudige Aufregung längst zu einer Wenigstens-tut-sich-was-Zufriedenheit gedämpft. Auch das lange Schlangestehen tun meine Freund*innen und ich uns nicht mehr an. Im Gegenteil: Meistens sind wir schon schelmisch stolz auf uns, wenn wir es überhaupt rechtzeitig zur Vorband schaffen, weil wir doch ach so cool und entspannt sind. Und insgeheim denken wir uns: „Verdammt, da wären noch zehn Minuten extra Powernap dringewesen.“
Natürlich steht dann längst nicht mehr zur Debatte, sich bis ganz nach vorne durchzuquälen. Mit einem fadenscheinigen bedauernden Blick nehmen wir unser Schicksal in den letzten Reihen hin. „Na gut, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig“, zucken wir uns gegenseitig mit den Schultern zu. Und insgeheim denke ich mir: „Yes, ich kann von hier aus jederzeit problemlos aufs Klo, wenn das Bier wieder mal Probleme macht.“ Aber hey, über die Videowalls sehen wir ja eh, was auf der Bühne abgeht, und sogar genauer als mitten in der Crowd hinter abartig hochgewachsenen Menschen, auf die ich komischerweise immer treffe, wenn ich mit anderen zu einem Publikum zwangsverschmelze.
Rein in die Pit
Auch meine Performance selbst habe ich früher um einiges ernster genommen. Immerhin habe ich zuhause mit ernstem Blick vorm Spiegel einige Moves geübt, die ich beim „Pogen“ und „Moshen“ einsetzen könnte. Es gehört schon viel Aufopferungsbereitschaft dazu, alleine vor dem Spiegel zu My Chemical Romance rumzuhüpfen. Aber der Adrenalinkick vor Ort war’s definitiv wert: Die zwei Minuten, in denen ich und meine Freund*innen beratschlagen, wer denn unsere Wertgegenstände an sich nimmt, während sich die anderen „reinhauen“, dauert eine halbe Ewigkeit.
Ein letzter Blick in die Augen der anderen, ein bestimmtes, langsames Nicken wie man es von Hollywood-Soldat*innen kennt, kurz bevor sie das Schlachtfeld stürmen, ein letzter tiefer Atemzug. Und los. Schon lassen wir uns mit panikgeweiteten Augen und ängstlich abwehrenden Händen von Wildfremden hin und her schleudern – „Nein, nein, nein, ups, sorry, Vorsicht, aaaah“ –, bis wir uns nach einer gefühlten Ewigkeit wieder an den Rand der „Pit“ retten können. Das war wichtig.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Verräterische Sandalen
Mittlerweile habe ich die praktische Skaterhose mit den tiefen aufgesetzten Taschen aber längst ausgemistet, die ich auf Konzerten aus strategischen Gründen trug – um mich ohne Handtasche „jederzeit reinhauen“ zu können. Auch beim Schuhwerk gehe ich mittlerweile nicht mehr nach dem „Falls mir jemand auf die Zehen hüpft“-Kriterium vor. Ja, bei meinem jüngsten Konzert war ich sogar demonstrativ in Römersandalen. Nicht einmal mehr den Anschein wahre ich, dass ich mich durch die Menge drängen werde und mich für etwaige rhythmische Handgemenge aufmagaziniert habe.
Nein, ein Blick auf meine blanken Zehen verrät: Die wird ein paar Bierchen zischen, mit illuminiertem Grinser in der letzten Reihe stehen und bei dem einzigen Lied, das sie kennt, einen zum Fremdschämen falschen Text mitsingen. Was man meinen Zehen nicht ansieht: Nach der Hälfte der musikalisch begleiteten Steherei fange ich bereits an abzuwägen, wie ungut es auffallen würde, wenn ich mich und meine vom Leben müden Glieder auf den Boden setzen würde. Bravo.
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Runter mit den Handys!
Mit den meisten dieser eventbezogenen Alterserscheinungen habe ich mich längst abgefunden. Ich werde es vermutlich nicht schaffen, mich in dieselbe verklärte Ekstase zu setzen wie früher. Punkt. Aber ein Phänomen stimmt mich auf Konzerten jedes Mal wehmütig, fast schon verbittert nostalgisch: die Sache mit den Handys. Ja, schon klar, dass ich mich damit anhöre wie der klassische 0815-Konzertgrantler. Aber jetzt mal ehrlich: Wenn Elton John „Candle in the Wind“ in die Menge schmalzt und zurück kommt nichts als der kalte Schein erleuchteter Handydisplays, macht einen das auch etwas unrund. Wo sind die Feuerzeuge hin, die man so lange in die Höhe hält, bis man sich den weißgequetschten Daumen verbrennt, dann kurz damit herumfuchtelt, um sie erneut emporzurecken? Wo ist die Mischung als kollektivem warmen Licht und individuellem Verzweifeln am Feuerzeugschnapperl hin?
Wobei auch das Handy- statt Feuerzeuggeleuchte im Sinne des Zeitgeists verkraftbar ist. Was ich allerdings wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man ein ganzes Konzert lang mit hochgehaltenem Handy mitfilmt, sodass alle, die hinter einem stehen, die Band nur durch Hunderte kleine Bildschirme beobachten können. Was machen die Leute mit diesen Videos? Sitzen sie nachher zuhause und schauen sich drei Stunden lang mit seligem Lächeln die ganze Show noch einmal an und seufzen: „Schee woar’s“? Ja, zwingen sie vielleicht sogar ihre Daheimgeblieben, sich die gesamte Aufnahme aufmerksam anzusehen? Und wenn ja: Warum?
Mit dem Laden des Inhaltes akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Giphy.
Mehr erfahren
Man könnte jetzt darüber philosophieren, dass wir verlernt haben, in den Moment einzutauchen, weil wir ihn lieber festhalten und für immer einfangen wollen. Man könnte sich jetzt über Instagram, Social Media und „dieses Internet“ auslassen, das uns alle zu Bildschirm hörigen Robotern macht. Oder man könnte einfach kurz vom Display aufblicken und sich auf das verdammte Konzert konzentrieren. Ist viel leiwander – auch von der letzten Reihe aus.
Darf’s noch ein bisserl mehr Senf sein? Unsere Redakteurin erzählt, warum das Schwimmband immer noch leiwand ist. Gemeinsames erotisches Baden findet sie allerdings ziemlich abtörnend.