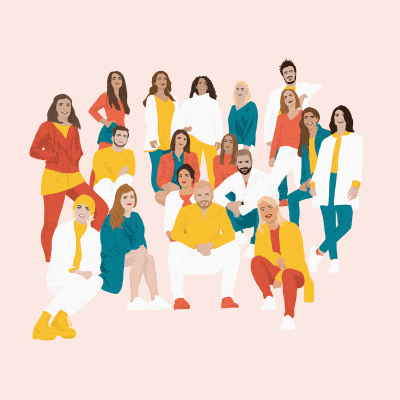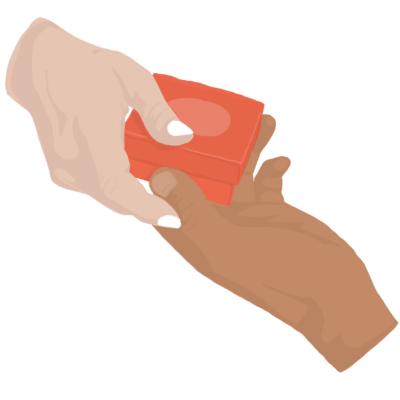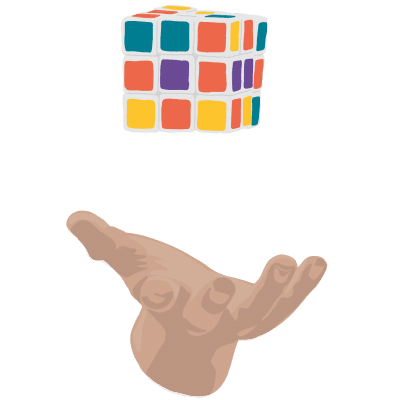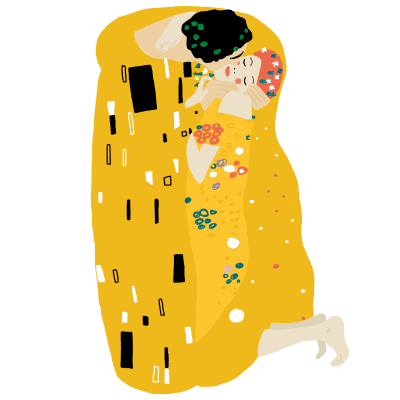Unser Senf: Was ich im Ausland wirklich an Wien vermisse
Weil ein bisschen Würze im Leben nie schaden kann, geben wir euch mit dieser Kolumne regelmäßig unseren Senf dazu: Wir erzählen euch, was uns beschäftigt, was uns nervt und was uns zum hysterischen Lachen bringt. Eure Käsekrainer könnt ihr zwar nicht darin eintunken, aber dafür ist unser Senf auch gratis. Dieses Mal erzählt unsere Redakteurin, was sie in ihrem Auslandsjahr in Brüssel in Wien am meisten vermisst.


Mit dem Begriff „zu Hause“ ist es ja so: Man kann zu Hause sein und sich zu Hause fühlen. Man kann aber auch nicht zu Hause sein und sich zu Hause fühlen. Oder man ist eben schon zu Hause, es fühlt sich aber nicht ganz nach „zu Hause“ an. Ich habe mein Zuhause verlegt. Nach Brüssel. Für etwas mehr als ein Jahr. Und nun ist zu Hause für mich die belgische Hauptstadt. Daheim ist hingegen noch immer Wien – aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Mein Zuhause in Brüssel hat sich für mich sofort heimelig angefühlt. Bis Brüssel mein Zuhause war, hat es ein bisschen länger gebraucht. Die Sprache ist anders, die Leute sind anders und erst das Müllsystem – das Müllsystem! Aber dazu komme ich gleich noch. Mit der Zeit kamen die lieben Menschen, die Hobbys, die Stammcafés – die Routinen eben – und schon haben sich meine fixen Wege in die undefinierbare Masse der Stadt und damit in mein Herz gebahnt.
An Brüssel liebe ich vieles. Die Laissez-Faire-Mentalität zum Beispiel, die sich Wien im Vergleich mit deutschen Städten gerne zuschreibt, aber in Wahrheit gar nicht hat und in Brüssel die Blumen in den Gassen sprießen lässt. Oder die konsequente Mehrsprachigkeit, die zwar auch Zeugin der Streitigkeiten in Belgien ist, aber Österreichs Drama um zweisprachige Ortstafeln noch lächerlicher wirken lässt. Und die ineinander übergehenden Gastgärten, die sogar im Winter voll sind und sich im Sommer in den städtischen Parks ausbreiten. Und so gerne ich mich als Bewohnerin und nicht nur als Besucherin sehe: Es gibt da ein paar Dinge, die mich sofort als Wienerin outen, noch bevor ich den ersten Satz auf Französisch mit Meidlinger Akzent gesagt habe.

Home is where the Schwarzbrot is
Es sind nur Kleinigkeiten und für eine begrenzte Zeit kann ich leicht darauf verzichten. Aber ich würde lügen, würde ich behaupten, nicht regelmäßig stolz auf die Vorzüge Wiens hingewiesen zu haben. Damit meine ich nicht etwa das kulturelle Angebot, die vielen Parks und Grünflächen oder die vergleichsweise günstige Miete (aber die natürlich auch!).
Es ist das gratis Glas Leitungswasser, das auch noch vorzüglich schmeckt und ungefragt zu Kaffee und Wein serviert wird. Der weiße Spritzer sowieso (wobei mir die Brüsseler Alternative „Half en Half“ aus Weißwein und Prosecco auch schon den ein oder anderen schönen Abend beschert hat). Oder das Soda Zitron – eine watscheneinfache, aber unschlagbar gute Alternative zu den gezuckerten Softdrinks, die es überall gibt. Und das Schwarzbrot, das Schwarzbrot in all seinen Formen und Farben, mit Knusperkruste und weichem Inneren.
Es ist das gratis Glas Leitungswasser, das auch noch vorzüglich schmeckt und ungefragt zu Kaffee und Wein serviert wird. Der weiße Spritzer sowieso (…). Oder das Soda Zitron“
ALISSA HACKER
Von meinen Kolleg*innen im Französischkurs habe ich bei meiner Ode an das Soda Zitron nur fragende Blicke erhalten, das könne man ja ganz einfach selber machen. Aber mit meinen kulinarischen Gelüsten bin ich nicht alleine! Ich habe mich schon mit anderen Österreicher*innen über das Leitungswasser und die fehlende Schwarzbrot-Auswahl gejammert. Geteiltes Leid ist eben halbes Leid. Und zum Glück wissen die, die schon länger hier sind, über die besten Bäckereien für Weißbrotüberdrüssige Bescheid (es gibt einen Marktstand einer Südtirolerin, wunderbar!).

Von Müllabfuhr bis Nacht-U-Bahn
Doch mir fehlt natürlich nicht nur die Kulinarik. Mir fehlt auch das Geld. Ausgehen in Brüssel ist ganz schön teuer. Das fängt schon beim Öffi-Ticket an: Über 500 Euro kostet eine Jahreskarte – und dann fährt noch nicht mal eine Nacht-U-Bahn. Dafür kann ich jedes Mal, wenn ich den Heimweg per Nachtbus antrete, meine Geschichten darüber zum Besten geben, wie es war, als ich in meiner Jugend noch ohne U-Bahn heimkommen musste (stellt euch hier bitte ein Oma-Emoji vor).
Und zum Abschluss muss ich ein paar Worte über das Müllsystem verlieren. Immerhin ist es Gesprächsthema Nummer eins, wenn Besuch aus der Heimat da ist. Vermutlich gibt es nichts an mir, das mehr „Wienerin“ sagt, als die Tatsache, dass ich eine Magistratsabteilung vermisse. Zur Erklärung für alle, die noch nie in Brüssel waren: Hier gibt es für jede Müllart einen Müllsack in bestimmter Farbe: orange ist für Bio-Müll, weiß für Restmüll und so weiter. Je nach Bezirk wird der Müll einer bestimmten Sorte an einem bestimmten Tag auf die Straße gelegt und dann abgeholt.
Vermutlich gibt es nichts an mir, das mehr „Wienerin“ sagt, als die Tatsache, dass ich eine Magistratsabteilung vermisse.
ALISSA HACKER

Dass sich in einer Millionenstadt nicht alle immer daran halten, versteht sich von selbst. Und so stürzen sich regelmäßig Raben auf die übriggebliebenen Müllsäcke und diversifizieren ihren Speiseplan. Ich muss zugeben, dass ich nicht weiß, wie man den Abfall richtig entsorgt, wenn man am richtigen Mülltag mal nicht in der Stadt ist. Deshalb habe ich jedes Mal klammheimlich den vollen Sack in den öffentlichen Mülleimer gestopft, bevor ich für ein paar Tage weg war. Es ist in Brüssel ein Running Gag, dass das System eben ist wie es ist. Aber wenn ich dann an der Haustür die passiv-aggressive Benachrichtigung darüber lese, dass man doch bitte den Müll ordnungsgemäß entsorgen solle – mit beigefügten Fotos von falsch platzierten Müllsäcken, versteht sich – dann fühle ich mich schon wieder fast wie daheim in Wien.